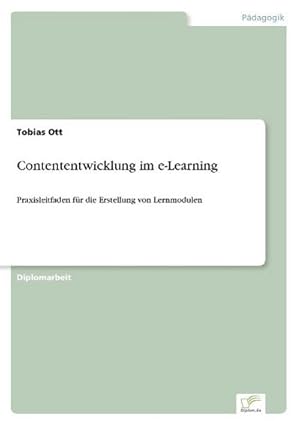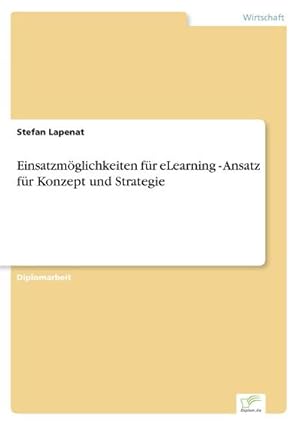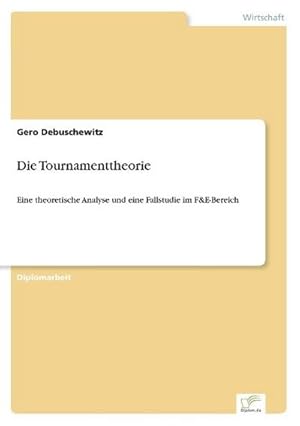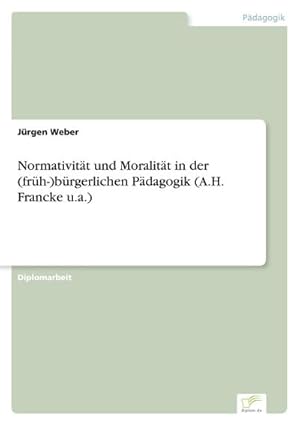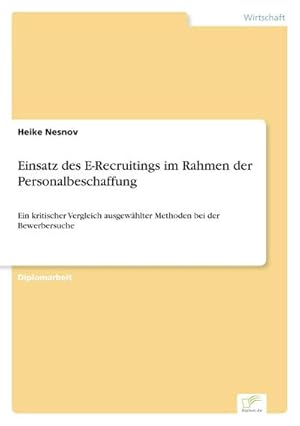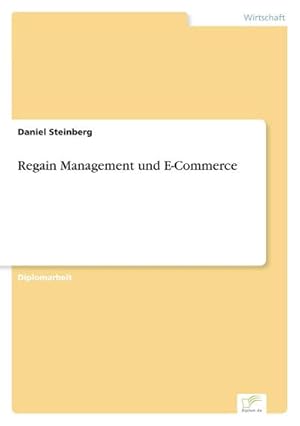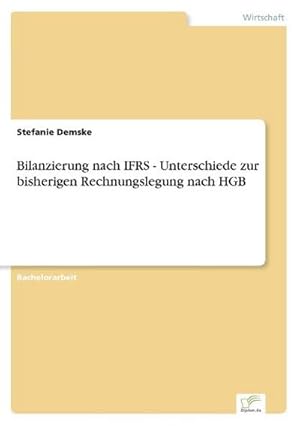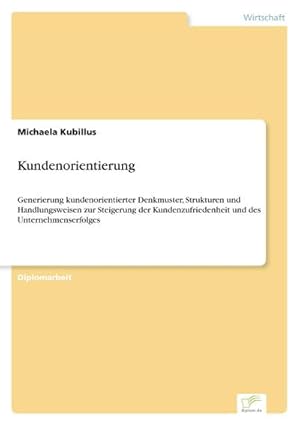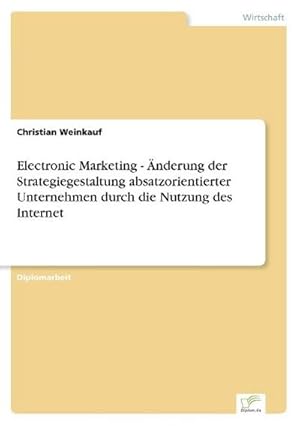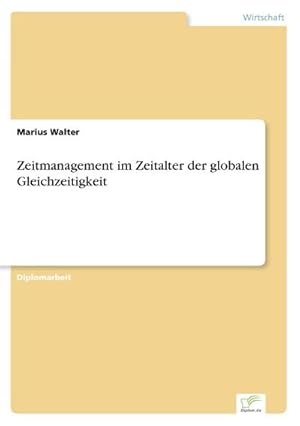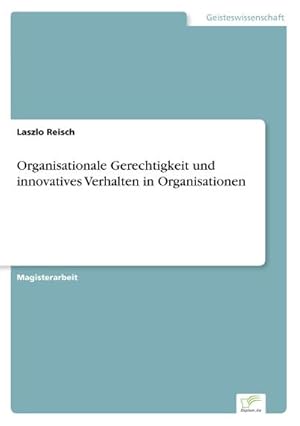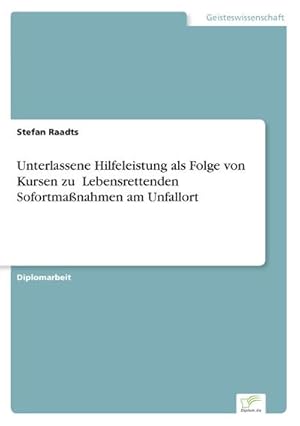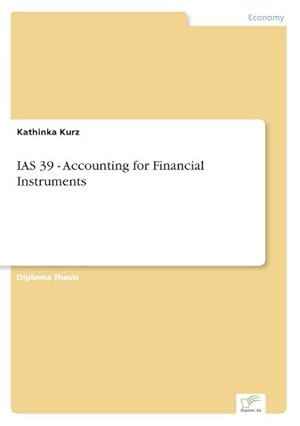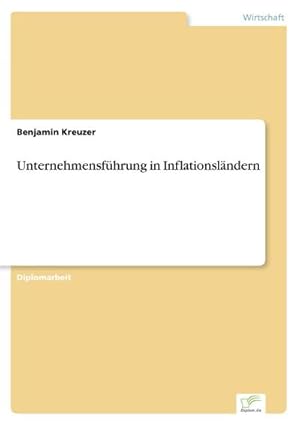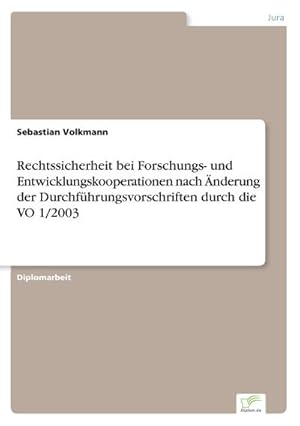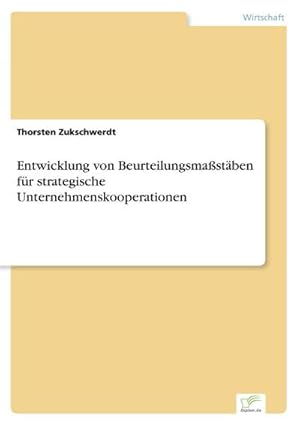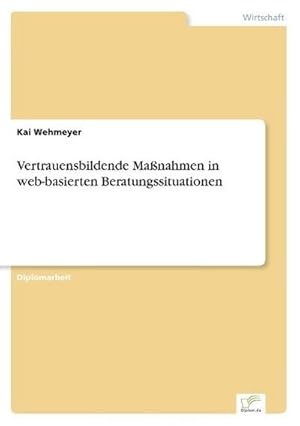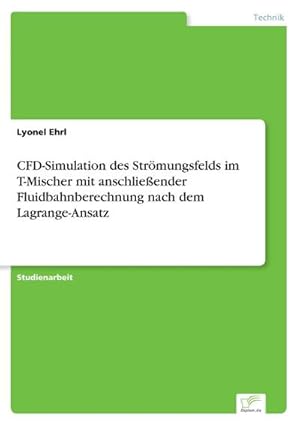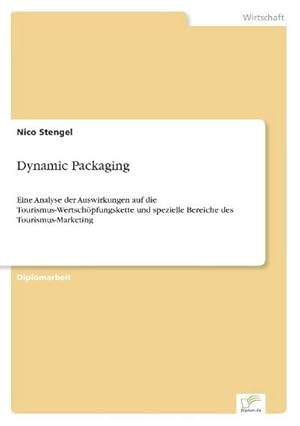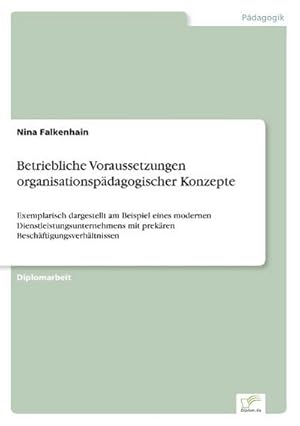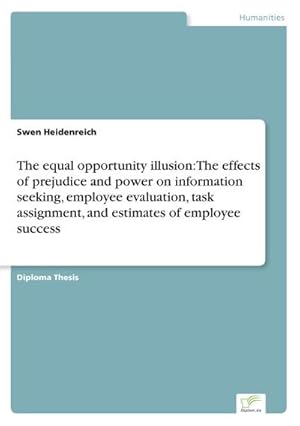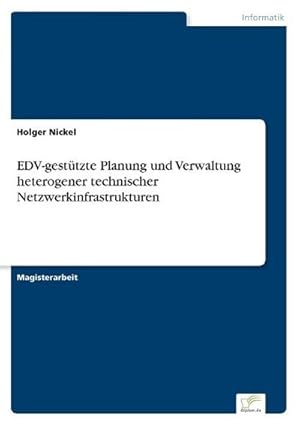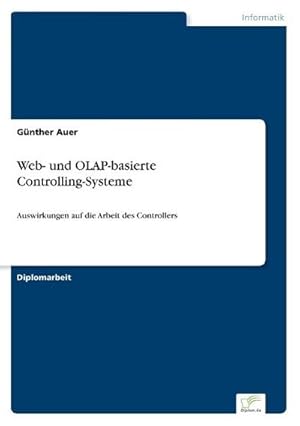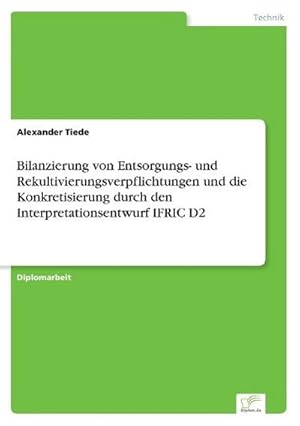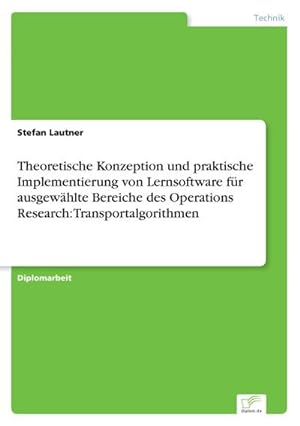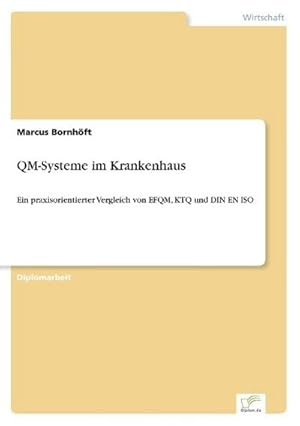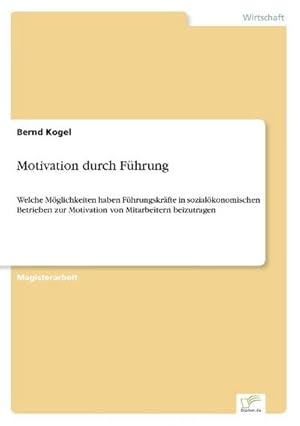diplom de okt 2004 (57 risultati)
Tipo di articolo
- Tutti i tipi di prodotto
- Libri (57)
- Riviste e Giornali
- Fumetti
- Spartiti
- Arte, Stampe e Poster
- Fotografie
- Mappe
- Manoscritti e Collezionismo cartaceo
Condizioni
- Tutte
- Nuovi (57)
- Antichi o usati
Legatura
- Tutte
- Rilegato
- Brossura (57)
Ulteriori caratteristiche
- Prima ed.
- Copia autograf.
- Sovracoperta
- Con foto (57)
- Non Print on Demand
Spedizione gratuita
- Spedizione gratuita negli USA
Paese del venditore
Valutazione venditore
-
Contententwicklung im e-Learning
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683625ISBN 13: 9783838683621
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Pädagogik - Allgemeine Didaktik, Erziehungsziele, Methoden, Note: 2,3, Fachhochschule Hof (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die Ausgangslage der folgenden Arbeit stelle man sich folgendermaßen vor: Die Personalabteilung hat sich für die Entwicklung eines e-Learning Moduls zur Schulung für die Vertriebsmitarbeiter entschieden und das Konzept für die Umsetzung soll erstellt werden. Der Personalverantwortliche will sich einen kurzen Überblick über das Thema verschaffen. Ein Trainer des Unternehmens, der bisher nicht mit e-Learning gearbeitet hat, soll bei der Konzeption und Drehbucherstellung mitwirken.Für diese und viele andere e-Learning-Szenarien soll diese Diplomarbeit schnell und praxisnah das wichtigste Wissen vermitteln und so den Funktionsträgern (Personalverantwortliche, Projektmitglieder, Fach- und Drehbuchautoren, Trainer) einen Einstieg in das Thema ermöglichen. Die Schwerpunkte der Arbeit sind in den Bereichen Methodik und Didaktik und im Design, da hier in der Praxis ein Bedarf an interdisziplinärem Wissen identifiziert werden konnte.Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen und Begriffe rund ums e-Learning angesprochen und wiederholt. Zum Einen ist eine Einführung in das Thema e-Learning und die damit verbundenen Begriffe und Systeme zu finden. Zum Anderen sind erste Grundlagen zur Konzeption, sowie Stichpunkte und erste Gedanken z.B. für eine Präsentation im Unternehmen oder beim Kunden dargestellt.Im dritten Kapitel sollen Grundlagen aus den Bereichen Methodik und Didaktik vermittelt werden. Auf die umfangreiche Vorstellung von wenig praxisrelevanten Theorien wurde bewusst verzichtet, um mehr Raum für Ideen und Anregungen zu bieten, die bei der Drehbucherstellung und Planung direkt umgesetzt werden können. Es werden zum Beispiel Antworten auf folgende Fragen gegeben: Welche Lerntheorien sind für e-Learning interessant Wie sollen Kurse methodisch und didaktisch aufgebaut werden Wie wird bei der Auswahl der einzelnen Inhalte vorgegangen Im vierten Kapitel werden grundsätzliche Ideen rund um die Themen Grafikdesign, Farben, Raster und Layout angesprochen. Gerade für den Drehbuchautor oder alle Mitarbeiter im Projektteam, die mit den verantwortlichen Designern und/oder Programmierern zusammenarbeiten ist ein Grundverständnis dieser Bereiche sinnvoll. So können qualitativ hochwertige Lernprodukte produziert werden, die nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch überzeugen. Die in diesem Kapitel aufgezeigten Regeln können jedoch auch für alle anderen Bereiche der Betriebswirtschaftslehre, die Schnittstellen zu den Bereichen Gestaltung und Design besitzen, eingesetzt werden so zum Beispiel bei Präsentationen, im Marketing oder bei der alltäglichen Arbeit mit Dokumenten.Im fünften Kapitel sollen abschließend Ansätze zur Kosten-Nutzen-Rechnung vorgestellt werden. Es werden zum Beispiel Antworten auf die folgenden Fragen erörtert: Lohnt sich der Einsatz von e-Learning Welche Kostenarten sind bei der Planung zu berücksichtigen Wann lohnt sich der Einsatz von e-Learning Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisVITabellenverzeichnisVIIIAbkürzungsverzeichnisX1.Einlei tung12.Grundlagen22.1Was ist e-Learning 22.1.1CBT (Computer Based Training)22.1.2WBT (Web Based Training)22.1.3Telekonferenz /Tutoring / virtuelle Klassenräume / etc.22.1.4Hypertexte und elektronische Bücher32.1.5Synchrone und asynchrone Kommunikation32.1.6Content42.1.7LMS (Learning Management System)42.1.8Beispielmodell52.2Voraussetzung für e-Learning62.2.1Persönliche Voraussetzungen des Lernenden62.2.2Voraussetzungen im Unternehmen62.3Vorteile und Nachteile von e-Learning82.4Blended-Learning92.5Grundgedanken zur U. 124 pp. Deutsch.
-
Einsatzmöglichkeiten für eLearning - Ansatz für Konzept und Strategie
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683579ISBN 13: 9783838683577
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 2,0, Fachhochschule Hof (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im fortschreitenden Informationszeitalter erhält für Unternehmen die breite Verteilung und schnelle Vermittlung von Wissen einen erfolgsentscheidenden Stellenwert. Auch für den einzelnen Mitarbeiter spielt das lebenslange Lernen eine wichtige Rolle beim Erhalt und Ausbau der beruflichen Fähigkeiten.Meist wird Bildung jedoch als reiner Kostenfaktor oder als Mittel zur Reduktion von Stückkosten betrachtet, Auswirkungen auf die Marktposition und die Unternehmensentwicklung bleiben unberücksichtigt.Innovative Möglichkeiten zu erkennen und umzusetzen ist laut Dr. Christoph Meier vom Fraunhofer IAO lohnend. Investitionen in Wissen erwirtschaften heute Kapitalrenditen von 17 Prozent und mehr nach Steuern, während Investitionen in Sachanlagen in der Regel gerade die Kapitalkosten decken. eLearning-Lösungen verknüpfen zukünftig immer stärker die Bereiche Lernen, Arbeiten und Wissen im Unternehmen. So suchen nicht nur allein Personal- und Bildungsverantwortliche nach innovativen Lernprozessen, sondern auch Fachabteilungen, die sich Produktivitäts- und Qualitätsverbesserungen erhoffen.Durch den Einsatz von eLearning sollen ein Kompetenzvorsprung gegenüber Wettbewerbern geschaffen, neue Produkte und Dienstleistungen schneller an dem Markt gebracht werden.Durch Internet-basierte Lernumgebungen werden den richtigen Mitarbeitern zur richtigen Zeit die richtigen Lern- und Informationsinhalte zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer greifen unabhängig von externen Zeitfaktoren und örtlichen Gegebenheiten selbstgesteuert auf diese zu.eLearning besteht somit nicht allein aus dem Einsatz von elektronischen Lernmodulen, sondern aus einem Gesamtkonzept mit einer Lernplattform und unterschiedlichen Kommunikationstechniken, die in den unterschiedlichsten Bereichen zur Anwendung kommen können.Durch Kombinationslösungen aus eLearning und Präsenzseminaren (das sog. blended-learning) werden Trainings- und Ausbildungskosten gesenkt, da ein großer Teil der mit Präsenzseminaren verbundenen Kosten für Reise und Unterbringung, Seminargebühren sowie für Material und Trainer entfallen. Außerdem verringern sich die Ausfallzeiten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.Aus der Aufrechnung von reduzierten, umgeschichteten und neu entstehenden Kosten für Entwicklung, Pflege und Implementierung eines eLearning-Systems können Rückschlüsse auf den Erfolg der Investition in Form des Maßstabs Return-on-Education gezogen werden.Neben diesen finanziellen Aspekten entstehen eine Menge weiterer positiver Veränderungen für Lerner, Trainer und das Unternehmen.Auch mögliche Schwächen wie fehlende soziale Interaktion der Teilnehmer untereinander, nicht adäquate Technologie und Didaktik, die zu einem Motivationsschwund des Lerners führen, müssen berücksichtigt und durch geeignete Gegenmaßnahmen ausgeglichen werden.Erfolgskriterium für die Einführung von eLearning ist eine nachhaltige Umsetzung auf Basis eines fundierten Konzepts. Hier wird nicht nur der Kauf und die Bereitstellung von Lernmaterial, sondern die Einbettung von eLearning in das Unternehmenskonzept aufgezeigt.Die Vielfältigkeit des Marktes der eLearning-Anbieter verlangt eine sorgfältige Auswahl der Projektpartner besonderes Augenmerk muss hier auf Durchhaltevermögen und Referenzprojekte des Anbieters gelegt werden. Da eLearning-Projekte weniger an Problemen der Hard- und Software, sondern häufiger an konzeptionellen Schwächen scheitern, sollte die Kernkompetenz des Anbieters in diesem Bereich liegen.Nachdem mögliche Verbesserungspotentiale gefunden und analysiert wurden, resultiert die Konzeption der Lehr- und Lernformen in den Anforderungen an das zu implementierende eLearn. 152 pp. Deutsch.
-
Die Tournamenttheorie
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683307ISBN 13: 9783838683300
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 2,0, Universität zu Köln (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Turniere sind Wettbewerbssituationen, in denen Individuen oder Kollektive relativ zur Leistung anderer Turnierteilnehmer belohnt werden. Im ökonomischen Kontext werden solche Leistungsturniere unter dem Begriff der Tournamenttheorie zusammengefasst.Die Anwendung von Turnieren als Anreizkonzept ist weit verbreitet und besitzt gerade dann Vorteile, wenn eine präzise Leistungsmessung schwierig ist, und Systeme wie individuelle Leistungslöhne aufgrund gemeinschaftlicher, äußerer Risiken nicht einsetzbar sind. Aufgrund u.a. dieser positiven Eigenschaften scheinen Leistungsturniere grundsätzlich ein geeignetes Instrument zu sein, um a) Mitarbeiter hinsichtlich einer höheren Arbeitsleistung zu motivieren bzw. zu kompensieren, und um b) aus einer scheinbar homogenen Arbeitnehmergruppe die geeignetsten Kandidaten für eine Beförderung, Gehaltserhöhung etc. auszuwählen.Die vorliegende Arbeit untersucht exemplarisch eine derartige Anwendung der Tournamenttheorie im komplexen Organisationsbereich für Forschung und Entwicklung eines Unternehmens.Auf fortschrittlicher personalökonomischer Basis werden dazu verschiedene Turniervarianten hergeleitet und in Ihrer Anreiz- und Motivationswirkung sowie Ihrem Nutzen ausführlich betrachtet. Neben der Grundform von Turnieren werden ebenfalls eventuelle Problembereiche beleuchtet. Zur modulartigen Erweiterung auf komplexere Situationen der Realität, werden daneben Asymmetrische Turniere eingeführt. Es wird argumentativ dargelegt, formal bewiesen und empirisch untermauert, dass auch solche Turniere ein überzeugendes personalpolitisches Anreizinstrument darstellen. Obendrein werden Maßnahmen aufgezeigt, die solche Turniere in der betrieblichen Praxis ermöglichen bzw. welche so genannte ungleiche und unfaire Turniere ausgleichen können. Auf innovative Art und Weise sowie auf Grundlage eines theoretisch fundierten ökonomischen Ansatzes entsteht die Möglichkeit, Leistungsturniere auch in solchen Situationen durchzuführen, welche auf den ersten Blick nicht geeignet erscheinen. Des Weiteren gibt diese Arbeit einen ausführlichen Einblick in die personalpolitischen Prozesse und Wirkungsweisen verschiedener Instrumente und Systeme, sie unterteilt sich wie folgt:Nach der Schilderung der Ausgangssituation (Gliederungspunkt 2) werden dem personalökonomischen Ansatz (Gliederungspunkt 3) folgend die grundsätzlichen Mechanismen der Tournamenttheorie sowie potenzielle Problemfelder erläutert (Gliederungspunkt 4). Mit Erweiterung des Modells auf asymmetrische Turniere sowie deren Ausgleichsmaßnahmen (Gliederungspunkt 5) wird die Basis dafür geschaffen, dass Turniere im betrachteten Bereich sowohl unter Selektions- als auch Motivationsgesichtspunkten prinzipiell einsetzbar sind Nach einem Überblick über die themenrelevanten empirischen Erkenntnisse bzgl. der Tournamenttheorie (Gliederungspunkt 5) werden diese Einsatzmöglichkeiten im Anwendungsfall untersucht (Gliederungspunkt 6) und bewertet (Gliederungspunkt 7). Zentrale Ergebnisse sind, dass Turniere theoretisch und empirisch äußerst effizient sind, bei Beförderungen und im modernen Performancemanagement einen nützlichen Beitrag leisten sowie eine Leistungsbeurteilung qualitativ verbessern können. Allerdings weisen Sie auch Schwachpunkte auf, welche jedoch durch geeignete Maßnahmen reduziert oder ausgeschlossen werden können. Turniere mit dem Ziel der Motivationssteigerung lassen im Szenario vielseitige und innovative Anwendungen zu und können modular als auch temporär veranstaltet werden. Grundsätzlich werden Leistungsturniere mit Individuen oder auch Teams als Teilnehmer in denkbar vielen Szenarien als sinnvolles und äußerst effizientes Anreizinstrument beurteilt, welches i. 104 pp. Deutsch.
-
Normativität und Moralität in der (früh-)bürgerlichen Pädagogik (A.H. Francke u.a.)
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683498ISBN 13: 9783838683492
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich Pädagogik - Allgemein, Note: 2,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Philosophische Fakultät III), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Mit dem Zug zu Rationalisierung der Wirtschaft im aufkommenden Rationalismus und Merkantilismus der Neuzeit war für Fürsten wie auch für die Handel treibenden Bürger die Notwendigkeit zur Formung eines neuen rationaler als früher arbeitenden und berechenbaren Menschen gegeben. Dem erzieherischen Denken des Pietismus nun und insbesondere dem theologischen und pädagogischen Anspruchs des Gründers der Halleschen Srtiftungen, August Hermann Francke (1663 1727), kann nun keineswegs nachgesagt werden, dass es a priori bloß die erzieherische Formung und Bereitstellung von Arbeitsklientel für die neuen ökonomischen Bedürnisse der frühkapitalitischen Gesellschaft intendiert hätte, ohne gerade die metaphysische Einbindung ihrer Zöglinge in ein christliches Weltbild und ein ebensolches Lebensgefühl und Ethos zu unternehmen: Letzteres war sicherlich der mächtigste pädagogische Antrieb, den man der Gefühlsfrömmigkeit der Pietesten plausibel und aufrichtig unterstellen möchte, wenn wir Ihre Schriften heute rezipieren.Zeichnen wir nun Franckes pädagogischen Gesamtentwurf nach, so gewahren wir als durchgängige Linie seines anthropologischen Denkens, dass das menschliche Wesen und hier folgt den christlichen Lehrern der Tradition von Augustinus an- durch die Erbsünde von der Wurzel her so verzerrt, gestört und verdunkelt ist, dass er von alleine niemals gut werden könnte und auch nicht zu einem guten und vernünftigen Handeln fähig wäre, würden ihn nicht christliche Lehre und Unterweisung leiten. Allerdings betont Francke noch deutlich mehr als z. B. die katholische Tradtion die absolute Verdorbenheit des Menschen vor der totalen Unterwerfung unter Gott (S. 24 32).Und nun kann es wohl kaum übertrieben heißen zu sagen, dass diese so von Francke verstandene und mittels seines Bekehrungserlebnisses auch praktizierte Unterwerfung unter Gottes Herrschaft in der erzieherischen Praxis zunächst die Unterwerfung unter die Herrschaft der sich selbst als Agenten Gottes wähnenden Pädagogen bedeuten mußte. Herrschaft insofern, dass die Organisationsweise der Franckeschen Pädagogik nachhaltig darauf ausgerichtet war, nicht nur an eine Anpassung und Einübung der Kinder unter die bestehenden Verhältnisse zu gelangen, sondern den Willen des Zöglings unter Kontrolle zu bringen, ja eigentlich ihn zu brechen, um ihn bereit werden zu lassen, sich in die christliche Schul- oder Gemeindeordnung willfährig einzufügen.Ab dem Punkt dieser Einsicht dürfen wir uns die Frage stellen, ob die Strenge der pietistischen Pädagogen und besonders Franckes, den in einer verdorbenen Welt völlig verloren gedachten Menschen entschlossen und sehr diszipliniert in eine höhere Wirklichkeit einzuführen, für viele so geprägte Individuen und Generationen tragische Züge annehmen mußte, allein schon in Hinsicht einer geglückten und reifen seelischen Entwicklung des Selbst. Zuletzt schließt sich der Kreis, blicken wir auf die so neu entstehenden Ausbeutungspotentiale für die sich im (früh-)bürgerlichen Zeitalter entfaltende merkantilistische Arbeits-organisation, welche in der europäischen Geschichte eine neue Dimension der Ausbeutung und Entfremdung von selbstbestimmter Arbeit darstellt.Bei aller Kritik an den in der Praxis in ihren psychischen Folgen für den einzelnen kaum problematisch genug einzuschätzenden Methoden von Franckes Erziehungslehre sollte selbstverständlich nicht vergessen werden, dass Francke mit seinem Organisationstalent es gelungen ist, den noch unter den Folgen des Dreißigjährigen Krieges leidenden Generationen von heimatlosen und als Proletarier dahinvegetierenden Kindern durch seine Anstaltsgründungen ein. 140 pp. Deutsch.
-
Interkulturelle Erziehung durch Kunst
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683315ISBN 13: 9783838683317
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Pädagogik - Allgemeine Didaktik, Erziehungsziele, Methoden, Note: 1,0, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Es geht heute verstärkt darum, im Bereich der Interkulturellen Erziehung neue Wege zu suchen, Wege, die meist nicht begradigt, geebnet oder geteert sind, die aber trotz ihres Unbegehbar-Erscheinens zugänglich gemacht werden können.Mittel einer Interkulturellen Erziehung erfordern in unserer heutigen Gesellschaft neue Formen und ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten. Nicht nur die Vermittlung der Zweisprachigkeit, sondern gerade die Einführung in unterschiedliche Rollenerwartungen verschiedener Kulturen, ihre Religionen, ihre Sitten etc. steht im Zentrum eines bewußten Umgangs mit der Interkulturalität. Notwendig ist hier das Handeln auf zwei Ebenen: einerseits die seelische Stärkung des Kindes, um es vor dem Zerbrechen an Diskriminierungserfahrungen wenigstens ansatzweise zu schützen zu versuchen, andererseits der Einsatz für gesellschaftliche Veränderungen, damit Rassismus und Vorurteilen frühzeitig Einhalt geboten werden kann.Da die Kunst in unserer Zeit stärker noch als in vergangenen Epochen gesellschaftliche Aufgaben hat, die nicht von der ästhetischen Dimension einer Arbeit zu trennen sind, liegt vor allem auch in diesem Bereich ein fruchtbarer Boden für eine Erziehung im interkulturellen Kontext. Kunst ist immer nur ein Glied des Lebens, ist eine schöpferische Tat des Menschen, der die eigene Existenz und seine Umgebung gestaltet und so künstlerisch den ihm zugänglichen Ausschnitt der Welt formt und organisiert. Der Versuch, diese stärkere Beachtung einer sich bereichernden Verknüpfung beider Bereiche im Sinne einer Interkulturellen Erziehung durch und in der Kunst zu vermitteln ist Hauptanliegen meiner Arbeit. .Zuerst trachte ein Mensch, der Poet sein will, nach völliger Selbsterkenntnis. Er suche seine Seele, durchforsche sie, begreife sie.Er muß, was er erdichtend entdeckt, fühlbar machen, tastbar, hörbar, und wenn das, was er von da unten heraufholt, Form besitzt, so gibt er es als Form; ist es formlos, dann gibt er das Formlose.- Eine Sprache finden.Aber das Unsichtbare sehen und das Unhörbare hören, ist eine andere Sache, als den Geist toter Dinge wiederzuwecken.Die Entdeckungen des Unbekannten fordern neue Formen. (Rimbaud)Man kann den heutigen Erziehungsauftrag definieren als Erziehung zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Krisenbewußtsein am Fin de siécle . Der Erziehungs- und Bildungsbegriff muß gemäß unserer gesellschaftlichen Entwicklung in viel größerem Rahmen gesehen werden; die Pädagogik muß auf diese Krise reagieren, versuchen, diese Chance zur Weiterentwicklung, trotz der damit verbundenen Risiken und der Angst vor Veränderung zu nutzen und sich gegenüber Innovationen öffnen und neue Ideen (oder alte Ideen in neuer Form ) aufnehmen. Verbesserungen vor allem im schulischen sowie im außerschulischen Bildungsbereich sind notwendig. Offensichtlich übt der Wandel der Sozialisationsbedingungen außerhalb von Schule großen Druck aus auf ihre Rolle und Funktion im Prozeß der Sozialisation; in dieser Situation der Verunsicherung müssen Bildungs- und Erziehungsinstitutionen ihre historische Rolle als Sozialisationsfelder im gesellschaftlichen und moralischen Kontext inhaltlich und formal neu begreifen und einen neuen Orientierungsraum bieten. Gerade Inhalte der Jugendkulturarbeit und einer erweiterten Jugendsozialarbeit, im kommerzialisierten bzw. privatisierten Sektor, sollten verstärkt in Angriff genommen werden; nur durch die Kooperation wird es künftig möglich sein, diesen einseitigen Entwicklungen und der Gefahr der Auseinanderentwicklung, der Trennung von Körper und Seele, entgegenzusteuern.Die volle Entfaltung der Persönlichkeit und des Gefühles ihrer. 176 pp. Deutsch.
-
Einsatz des E-Recruitings im Rahmen der Personalbeschaffung
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683587ISBN 13: 9783838683584
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 1,7, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Our assets are our people [.] , mit diesem Leitsatz ihrer Geschäftsphilosophie unterstreicht eine Investmentbank die Wichtigkeit eines guten Mitarbeiterstammes. Die Möglichkeiten für Unternehmen, Personal zu beschaffen und damit den Personalbedarf zu decken bzw. für Bewerber, eine neue Arbeitsstelle zu finden, sind vielfältig. In Zeiten der immer größer werdenden Popularität des Internets , hat sich neben der klassischen Personalbeschaffung (auch: Print Recruiting) die virtuelle Personalbeschaffung (auch: E-Recruiting) als moderne Form der Personalbeschaffung entwickelt.Online Stellen auszuschreiben oder sich online zu bewerben, ist für viele Unternehmen und Bewerber zur Normalität geworden. Für die meisten Recruiter stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie für die Beschaffung von attraktiven und hochqualifizierten Nachwuchskräften das Internet überhaupt einsetzen. Vielmehr geht es darum, je nach Recruiting-Zielgruppe die ideale Mischung aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Instrumenten sowohl der klassischen Personalbeschaffung als auch des E-Recruitings zu finden.Wie in vielen anderen Bereichen (z. B. Wertpapierhandel, Pharmaindustrie, Musikbranche), gelten die USA auch beim E-Recruiting als Vorreiter, weshalb viele Begriffe aus dem englischen in den deutschen Sprachgebrauch übernommen worden sind. Im Gegensatz zu den USA hat sich in Europa das E-Recruiting noch nicht vollständig etabliert, befindet sich jedoch in der ununterbrochenen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund haben die hier genannten Zahlen und Daten nur vorübergehende Gültigkeit und können bei Abgabe der Arbeit bereits veraltet sein.Gang der Untersuchung:Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Möglichkeiten ausgewählter Teilbereiche des externen Print und E-Recruitings vorzustellen und anschließend einem kritischen Vergleich zu unterziehen. Diese Teilbereiche beinhalten die Anzeigenschaltung durch die Unternehmen und die Suche nach Bewerbern über Dritte, die Vorauswahl auf der Bewerberseite, den Eingang der Bewerbungsunterlagen und die Vorauswahl auf der Unternehmensseite. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse gilt es abschließend, eine optimale Kombination aus den bearbeiteten Instrumenten der beiden Beschaffungsformen für die Akquisition von Hochschulabsolventen und Young Professionals eines Großunternehmens zu ermitteln.Die Darstellung erfolgt vorwiegend aus Unternehmenssicht unter gelegentlicher Einbeziehung der Bewerbersicht, da es aufzuzeigen gilt, auf welche Weise Unternehmen die klassische und die moderne Form der Personalbeschaffung am effizientesten kombinieren können. Um einen Überblick über die Personalbeschaffung als solche und die später in der Arbeit verwendeten Unterscheidungsmerkmale zu bekommen, wird zunächst eine allgemeine Erläuterung dieser Begriffe vorgenommen.Darauf folgt die Vorstellung der oben genannten Teilbereiche unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Methoden der klassischen Personalbeschaffung und des E-Recruitings. Im Hauptteil findet eine Gegenüberstellung dieser Methoden unter monetären und nicht monetären Gesichtspunkten statt, welche die Grundlage für die anschließende Ermittlung einer optimalen Kombination der Instrumente beider Bereiche bildet. Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche Trends in der Personalbeschaffung gegeben.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisV1.Einle itung11.1Zielsetzung11.2Vorgehensweise in der Arbeit22.Ausgewählte Teilbereiche der Personalbeschaffung32.1Übersicht verwendeter Begriffe32.1.1Inhaltliche Abgrenz. 60 pp. Deutsch.
-
Regain Management und E-Commerce
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683439ISBN 13: 9783838683430
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,3, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Die bisher kaum beantwortete Frage, inwieweit der Einsatz des Electronic Commerce (E-Commerce) im Rahmen des Regain Managements sinnvoll sein kann, soll Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sein. Im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements stellt das Kundenrückgewinnungsmanagement dabei den dritten abnehmergerichteten Strategieansatz neben der Neukundengewinnung und dem Kundenbindungsmanagement dar. Maßnahmen des Kundenrückgewinnungsmanagements setzen in diesem Zusammenhang dort ein, wo Aktivitäten des Kundenbindungsmanagements erfolglos geblieben sind. Das primäre Ziel des Regain Managements kann dabei darin gesehen werden, abgewanderte Kunden dazu zu bewegen, die Geschäftsbeziehung wieder aufzunehmen.Aufgrund der Erkenntnis, dass langfristige Kundenbeziehungen häufig von einer höheren Profitabilität gekennzeichnet sind, als kurzfristig transaktionsorientierte Beziehungen, hat das Kundenmanagement als wesentlicher Bestandteil einer verstärkten Kundenorientierung im Rahmen der Marketingwissenschaft und -praxis zunehmend an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang wirft das in vielen Branchen immer noch festzustellende starke Wachstum des E-Commerce die Frage auf, wie sich die bestehenden Kenntnisse für das Kundenmanagement geändert haben bzw. noch ändern könnten. Inwiefern E-Commerce zur Neukundengewinnung und insbesondere zur Kundenbindung beitragen kann, scheint dabei bereits ausführlicher behandelt worden zu sein als die im Rahmen dieser Arbeit behandelte Frage, ob und wenn ja, wie E-Commerce im Rahmen des Kundenrückgewinnungsmanagements eingesetzt werden kann. Dabei wird neben dem E-Commerce besonders auch für das Regain Management im Rahmen des wohl ohnehin immer bedeutender werdenden Kundenmanagements ein überproportionaler Bedeutungszuwachs prognostiziert. Eine Ursache dieses Bedeutungszuwachses kann in der in vielen Branchen beobachtbaren Zunahme der Wechselbereitschaft (Churn) gesehen werden. Ein Überblick darüber, wie diese Zusammenhänge und offene Fragen näher untersucht werden sollen, wird im nachfolgenden Abschnitt gegeben.Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung, unter der eine Folge von Marktransaktionen, die nicht zufällig ist verstanden werden kann, sollen sowohl Markttransaktionen zwischen Unternehmen und Endverbrauchern (Business-to-Consumer bzw. B2C) als auch solche zwischen zwei Unternehmen (Business-to-Business bzw. B2B) betrachtet werden. Das aussichts-reichere Feld des E-Commerce scheint dabei zwar im B2B-Bereich zu liegen, aufgrund der bisherigen Literatur zum Regain Management kann jedoch vermutet werden, dass dieses für beide Bereiche von hoher Bedeutung ist. Somit scheint es auch für diese Arbeit zweckmäßig, die Betrachtungen nicht lediglich auf einen Bereich zu beschränken.Ferner soll sich die Arbeit nicht nur auf Kunden beschränken, die bereits vor ihrer Abwanderung die Möglichkeiten des E-Commerce genutzt haben. Stattdessen soll auch untersucht werden, inwieweit solche Kunden zur Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen bewegt werden können, welche bis dato nicht von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht haben.Wenn man davon ausgeht, dass das Interesse an der Wiederaufnahme einer kundenseitig beendeten Geschäftsbeziehung primär auf Seiten des Anbieters gesehen werden kann, so soll sich auch für die weiteren Ausführungen dieser Arbeit größtenteils auf diese Perspektive beschränkt werden. Die vorliegende Untersuchung ist dabei in 6 Kapitel gegliedert.Nach den einführenden Gedanken des ersten Kapitels erfolgt in Kapitel zwei zunächst eine für die vorliegende Untersuchung zweckmäßig erscheinende Abgrenzung des Begriffs . 76 pp. Deutsch.
-
Bilanzierung nach IFRS - Unterschiede zur bisherigen Rechnungslegung nach HGB
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683420ISBN 13: 9783838683423
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Zeppelin University Friedrichshafen (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die Entwicklung der Wirtschaft ging im Laufe der vergangenen Jahre oder auch Jahrzehnte immer mehr in Richtung Globalisierung. So haben viele Unternehmen Teile ihrer Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagert. Gerade vor der EU - Osterweiterung zum 1. Mai 2004 ist diese Problematik wieder sehr aktuell geworden. Und sie wird in Zukunft auch immer an Aktualität gewinnen. Oftmals gründen Unternehmen, die in Deutschland produzieren, aus verkaufstaktischen Gründen sowie steuerlichen und rechtlichen Aspekten Tochterunternehmen im Ausland, die allein für den Vertrieb zuständig sind.So kann es sein, dass ein deutsches Unternehmen in Ungarn und Polen produzieren lässt und in drei seiner Hauptabnehmerländer Tochtergesellschaften zum Vertrieb aufbaut. So ist ein deutscher Konzern mit fünf Tochtergesellschaften entstanden. Jede der fünf Niederlassungen berichtet nun nach ihren nationalen Rechnungslegungsstandards an die Muttergesellschaft in Deutschland, die selber nach dem deutschen Recht bilanziert. Somit wird das Konzernreporting schnell unübersichtlich, ineffizient und teuer. Darüber hinaus benötigt das Unternehmen mehr Zeit, um auf eventuelle Fehlentwicklungen reagieren zu können.Mit dieser Entwicklung der Globalisierung hat sich auch die internationale Rechnungslegung entwickelt. In den letzten Jahren ist dieser Prozess als regelrecht rasant zu bezeichnen. Den bisherigen Höhepunkt erlebten die International Financial Reporting Standards (IFRS) mit der EG Verordnung im Jahre 2002, in der festgelegt wurde, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen in der EU ab 2005 Konzernabschlüsse nur noch nach IFRS aufstellen müssen.Die folgende Arbeit stellt die Bilanzierung nach IFRS der bisherigen deutschen Bilanzierung entsprechend dem deutschen Rechnungslegungsstandard nach dem HGB gegenüber.Zunächst wird im Kapitel 2 auf den organisatorischen Aufbau des International Accounting Standard Committee (IASC) und die bisherige Verbreitung und Anwendung der IFRS eingegangen.Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Systematik der IFRS, um so die Arbeit mit den Standards zu erleichtern.Der Kern dieser Arbeit liegt in den Kapiteln 4 und 5. Im Kapitel 4 werden Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen sowohl nach HGB als auch nach IFRS näher betrachtet und die wichtigsten Unterschiede herausgearbeitet. Dabei wurde hier nur eine Auswahl der wichtigsten Bilanzpositionen getroffen, da die Gegenüberstellung jeder einzelnen Bilanzposition den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Das Kapitel 5 zeigt zwei Spezialfälle, das Leasing und die latenten Steuern und deren unterschiedliche Behandlung nach IFRS und der deutschen Rechnungslegung.Das letzte Kapitel soll die IFRS im Gesamtbild mit den Normen nach HGB vergleichen und einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABKÜRZUNGSVERZEICHNISIVABBILDUNGSVERZEICHNISVITABELLENVERZEICHNISVI1.EINLEI TUNG12.ZUSAMMENSETZUNG DES IASC UND VERBREITUNG DER IFRS22.1ORGANISATION DES IASC22.1.1IASB32.1.2TRUSTEES32.1.3IFRIC42.1.4ADVISORY COMMITTEES42.2VERBREITUNG UND ANWENDUNG DER IFRS43.SYSTEMATIK DER IFRS53.1VORWORT (PREFACE)53.2RAHMENKONZEPT (FRAMEWORK)53.3STANDARDS63.4INTERPRETATIONEN DES IFRIC64.ANSATZ UND BEWERTUNG EINZELNER BILANZPOSITIONEN64.1BEWERTUNGSGRUNDLAGEN74.1.1ANSCHAFFUNGSKOSTEN74.1.1.1HGB74.1.1.2IFRS74.1. 1.3Zusammenfassung84.1.2HERSTELLUNGSKOSTEN84.1.2.1HGB84.1.2. 2IFRS94.1.2.3Zusammenfassung94.2BILANZGLIEDERUNG114.2.1HGB11 4.2.2IFRS114.2.3ZUSAMME. 76 pp. Deutsch.
-
Kundenorientierung
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683412ISBN 13: 9783838683416
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 2,0, Fachhochschule Kiel (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Im Laufe der vergangenen Jahre ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer kundenorientierten Unternehmensführung deutlich angestiegen. Wie nur wenige andere Themen erfährt der Bereich der Kundenorientierung zur Zeit breite Aufmerksamkeit; doch trotz der Einsicht in das Erfordernis verbesserter Leistungen am Kunden weist die praktische Umsetzung immer noch erhebliche Lücken auf. Theoretisch besteht heutzutage kein Zweifel mehr daran, dass die Fähigkeit von Unternehmen, Kundenorientierung sowohl intern als auch am Markt durchzusetzen, einen zentralen Erfolgsfaktor der Unternehmensführung darstellt. Auch in Zukunft werden unserer Märkte geprägt sein vom Wandel des Verkäufermarktes zum Käufermarkt und eine stärkere Positionierung der Kunden ermöglichen. Der Wettbewerbsdruck nimmt durch fortschreitende Internationalisierung, hohem Sättigungsniveau und immer rascheren technologischen Wandel weiterhin zu.In den vergangenen Jahren konnten bereits zahlreiche Initiativen auf dem Gebiet der Kundenorientierung beobachtet werden. Begriffe wie Total Customer Care oder Customer Relationship Management sind modern, treffen den Zeitgeist der Menschen und viele Unternehmen rühmen sich, auf diesem Gebiet bereits weitreichende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Dabei ist in der Unternehmenspraxis, wenn überhaupt, eine überwiegend technologische Interpretation dieses Begriffes und dementsprechend der Einsatz von entsprechender Software zur Steuerung von Kundenbeziehungen zu beobachten.Trotz allem Aktionismus stellt sich jedoch häufig eine Steigerung der Kundenorientierung nicht ein. Die Wirklichkeit vieler Unternehmen sieht meist so aus, dass zwar an ausgewählten Einzelaspekten, wie z.B. Kundendatenbanken oder Call Centern gearbeitet wird, ein integriertes Gesamtkonzept zur Durchsetzung von Kundenorientierung im realen Unternehmensalltag aber fehlt. Eine Verbindung von strategischen Initiativen und anschließender operativer Umsetzung wird nur unzureichend oder gar nicht geschafft. Unternehmen nutzen darüber hinaus gerne den Begriff der Kundenorientierung um ihren Kunden einen häufig nicht vorhandenen Wettbewerbsvorteil zu suggerieren und fallen dabei in eine Lücke zwischen kommunizierten Anspruch und gelebter Wirklichkeit.Gang der UntersuchungZiel dieser Arbeit ist es, Kundenorientierung als einen integrierten Gesamtprozess darzustellen, in dem der Kunde und seine individuellen Erwartungen und Bedürfnisse im Fokus der Untersuchung stehen und geeignete Managementsysteme und Maßnahmen aufgezeigt werden, um Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu erreichen.Ausgehend davon gilt es zunächst den Begriff der Kundenorientierung zu klären und eindeutig zu definieren. Es wird auf die Entwicklung der Kundenorientierung im Laufe der Zeit eingegangen und geklärt, warum weiterhin notwendiger Handlungsbedarf besteht. Hierauf rückt der Konsument und seine Motivation in den Mittelpunkt. Die Bedeutung und Voraussetzungen für Kundenzufriedenheit werden aufgezeigt und der Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erläutert. Im Anschluss wird auf die einzelnen strategischen Bausteine der Kundenorientierung ausführlich eingegangen und auf ihre Bedeutung im Rahmen der Unternehmensführung hingewiesen.Ein praktisches Fallbeispiel veranschaulicht in Kapitel 6 die bis dahin behandelten Ansätze. Anhand des Einrichtungshauses IKEA werden Kundenbindungs- und Servicemaßnahmen am Beispiel des Kundenclubs Family plastisch dargestellt und auf die Ausgestaltung sowie Umsetzung des Konzeptes eingegangen. Die Untersuchung erfolgte größtenteils mit Hilfe sekundärer Informationsquellen, wie Internet oder entsprechender Literatur, aber . 144 pp. Deutsch.
-
Electronic Marketing - Änderung der Strategiegestaltung absatzorientierter Unternehmen durch die Nutzung des Internet
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683536ISBN 13: 9783838683539
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Seit der zunehmenden Kommerzialisierung des Internet seit ungefähr Mitte der 90er Jahre scheint es das alles entscheidende Management-Paradigma zu sein, das Internet unternehmerisch nutzbar zu machen. Konzepte wie E-Procurement, (E-)Supply Chain Management, E-Learning oder (E-)Customer Relationship Management versprechen wirtschaftliche Potentiale, die es für die Management-Ebenen der Unternehmen beinahe zur Verpflichtung werden lassen, diese modernen Ansätze zu integrieren. In der Literatur wird bereits von einem Paradigmenwechsel von Atomen zu Bits gesprochen (vgl. Negroponte 1995, S. 19 ff.).Während dabei der Eindruck entsteht, das Internet habe den unternehmerischen Alltag ausschließlich bereichert, zeugen veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel abnehmende Produktlebenszyklen, wachsender Preisdruck, zunehmende Globalisierungstendenzen oder steigende Nachfragemacht eher vom Gegenteil. So scheinen die Möglichkeiten durch das Internet zwar gestiegen zu sein, dies jedoch unter deutlich anspruchsvolleren Wettbewerbsbedingungen.Beim Marketing als Maxime, Mittel und Methode des modernen Managements, machen sich diese Entwicklungen besonders bemerkbar: Unter dem Begriff Electronic Marketing zeugen neue Ansätze, wie Permission Marketing, Viral Marketing, One-to-One Marketing oder Community Building von grundlegenden Erweiterungen der traditionellen Marketing-Strategien. Scheinbar unveränderliche Marketing-Prinzipien, wie das Push-Prinzip oder die Ein-Wege-Kommunikation werden durch die neuen Gesetze und Möglichkeiten des Internet in Frage gestellt: Während auf traditionellen Märkten die Unternehmen einen klaren Informationsvorsprung gegenüber dem Kunden genießen, kehrt sich durch das Internet das Machtverhältnis zugunsten des Nachfragers immer mehr um.E-Marketing ist eines der bekanntesten Begriffsneubildungen der Internet-Zeit und bedeutet allgemein die verstärkte Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung des Marketing. Manche Autoren bieten jedoch noch weitere treffende Übersetzungen für E-Marketing an, die zusammen die verschiedenen Aspekte dieses Ausdrucks widerspiegeln sollen. So könnte das E beispielsweise für Extended stehen, also für eine Erweiterung des traditionellen Marketing durch die Nutzung neuer Instrumente (CRM, Data Mining etc.). Eine Übersetzung in Esteem-Marketing unterstreicht dagegen den intensivierten Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Konsumenten und ein Exchange-Marketing weist auf die Notwendigkeit einer Optimierten Schnittstellengestaltung zum Kunden hin (vgl. Herrman/Sulzmaier 2001, S. 14 f.).Diese vier Aspekte deuten auf weitreichende Unterschiede zwischen E-Marketing und traditionellem Marketing hin. Die Unterschiede, sowie die relevanten Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich in Bezug auf die Gestaltung von Marketingstrategien durch das Internet ergeben, sollen im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht werden.Ziel der Arbeit:Vorliegende Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Internet auf die Strategiegestaltung absatzorientierter Unternehmen. Dabei sollen zwei zentrale Aspekte betrachtet werden:Zum einen werden die veränderten absatz- und wettbewerbspolitischen Rahmenbedingungen, die sich durch die zunehmende Verbreitung des Internet ergeben untersucht und darüber hinaus die Implikationen der veränderten Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Marketingstrategien dargestellt. Als zweiter zentraler Aspekt werden die veränderten marketingstrategischen Möglichkeiten analysiert, die sich für absatzorientierte Unternehmen durch die Internettechnologie und die Internet. 128 pp. Deutsch.
-
Zeitmanagement im Zeitalter der globalen Gleichzeitigkeit
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683617ISBN 13: 9783838683614
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 96 pp. Deutsch.
-
Organisationale Gerechtigkeit und innovatives Verhalten in Organisationen
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 383868351XISBN 13: 9783838683515
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Magisterarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Psychologie - Arbeit, Betrieb, Organisation und Wirtschaft, Note: 1,7, Ludwig-Maximilians-Universität München (Psychologie und Pädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Es werden die möglichen Zusammenhänge zwischen den Dimensionen Organisationaler Gerechtigkeit und individuellem innovativen Verhalten am Arbeitsplatz untersucht. 127 Teilnehmer, die in Organisationen arbeiteten, welche standardisierte Leistungsbeurteilungsgespräche einsetzen, beantworteten eine deutschsprachige Übersetzung des Fragebogens von Colquitt (2001) zur Messung Organisationaler Gerechtigkeit bei Beurteilungsgesprächen. Zusätzlich wurde individuelles innovatives Verhalten sowie mehrere Kontrollvariablen mittels bereits validierten Skalen und einigen eigenentwickelten Fragen operationalisiert. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass Interpersonale und Prozedurale Gerechtigkeit in einem negativen Zusammenhang mit der Beteiligung am offiziellen Vorschlagswesen stehen, wobei Leader-Member Exchange Quality einen Mediationseffekt auf diese Zusammenhänge ausübt. Gleichzeitig fand sich ein positiver Zusammenhang zwischen Verteilungs-Gerechtigkeit und dem Einbringen von inoffiziellen Verbesserungsvorschlägen am direkten Arbeitsplatz. Kontrollvariablen wie Eigeninitiative, Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung, Ideen haben, und intrinsische Arbeitsmotivation stehen, wie aus Innovationstheorien ableitbar, generell in positivem Zusammenhang zu Aspekten individuellem innovativen Verhaltens. Die praktischen und theoretischen Implikationen dieser Befunde für Gerechtigkeits- und Innovationstheorien werden diskutiert.Abstract:Possible connections between the dimensions of Organizational Justice and individual innovative behavior at the workplace are examined. 127 participants working in organizations using standardized performance evaluation conversations answered a German translation of a questionnaire by Colquitt (2001) for the measurement of Organizational Justice during evaluation conversations. Additionally, individual innovative behavior as well as several control variables were operationalized via validated scales and some self-developed questions. Results indicate that Interpersonal and Procedural Justice display a negative connection with participation in official suggestion systems, with Leader-Member Exchange Quality exerting a mediating effect on these connections. Simultaneously, a positive connection was found between Distributive Justice and the contribution of unofficial improvement suggestions at the direct workplace. Control variables such as Self-Initiative, need for personal development, having Ideas and intrinsic work motivation were found to be in a generally positive relationship to aspects of individual innovative behavior, as was deducible from innovation theory. Implications of these results for theories of justice and innovation will be discussed.Einleitung:In den letzten Jahren sind sowohl Gerechtigkeit wie auch Innovation zu wichtigen Forschungsgebieten der Sozialwissenschaften geworden. Gerechtigkeit wird dabei nicht als objektiv greifbares Konzept betrachtet. Vielmehr handelt es sich um ein gesellschaftliches und soziales Konstrukt, welches subjektiv wahrgenommen und empfunden wird. Die individuelle Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ergibt sich durch die soziale Interaktion mit anderen Individuen, Gruppen und Organisationen. Einige Forscher sehen den Wert der Gerechtigkeitsforschung darin, dass Gerechtigkeit eine wichtige gesellschaftliche Vermittlungsfunktion übernimmt, da das Streben nach Gerechtigkeit Menschen und Gruppen überhaupt erst erlaube, miteinander zu interagieren, ohne dass es zu Konflikten und einem gesellschaftlichen Zusammenbruch kommt (Tyler, 2000). Damit ist das Konzept der Gerechtigkeit jedoch nur dann von Nutzen, wenn die Mehrzahl von Gruppen oder Organisa. 124 pp. Deutsch.
-
Unterlassene Hilfeleistung als Folge von Kursen zu ?Lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort?
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683765ISBN 13: 9783838683768
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Psychologie - Sozialpsychologie, Note: 1,0, Universität Osnabrück (Humanwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie befahren mit 90 km/h eine Landstraße und beobachten, wie 80 m vor Ihnen ein Wagen von der Straße abkommt und sich überschlägt (alternativ kann es auch ein Fahrradfahrer sein, der auf nassem Laub ausrutscht und zu Boden fallt oder jede andere Situation, die Ihnen dazu in den Sinn kommt). Etwa drei Sekunden später passieren Sie diese Stelle. Sie bemerken, wie Ihr Fuß automatisch die Bremse betätigen will, jedoch haftet Ihr Blick nicht nur auf die Unfallstelle, sondern auch im Rückspiegel auf den nachfolgenden Verkehr. Vielleicht ist vor Ihnen auch bereits ein Wagen vorübergefahren. Wenn Sie jetzt nicht schleunigst auf die Bremse treten, werden Sie den Straftatbestand der Unterlassenen Hilfeleistung im Straßenverkehr erfülle& Nun, wird hoffentlich nicht so schlimm verlaufen sein. Da sind ja auch noch andere, die anhalten können. Und doch bleibt da so ein mulmig-schuldiges Gefühl . es ist ja im Grunde nicht möglich, die Schwere von eventuellen Verletzungen aus dem Auto heraus zu ergründen. Dazu hätten Sie anhalten müssen.Sie wurden auf diese Situation niemals vorbereitet. Da gab es sicher mal einen Erste-Hilfe-Kurs. Jedoch bereitet dieser nur auf die Situation NACH dem Anhalten vor. Den Prozess des Anhaltens selbst haben Sie noch nie antizipiert. Nach juristischen Gesichtspunkten drohen Ihnen jetzt Geldstraße oder bis zu einem Jahr Gefängnis (323c StGB). Wenn diese alltäglich vorkommende Situation aber zu solchen Strafen führen kann, dann muß der Gesetzgeber auch eine adäquate Vorbereitung auf diese Situation garantieren. Und ein Kurs zu Lebensrettenden Sofortmaßnahmen , wie er nun mal für Führerscheinbewerber Vorschrift ist, leistet diese Vorbereitung nicht. Im Gegenteil: häufig empfinden die Teilnehmer die Ausbildung als hemmend, da sie auf schwer zu lösende Situationen fokussiert (wer kann schon etliche Jahre später noch eine Stabile Seitenlage herstellen oder eine Reanimation durchführen - oder kann sich überhaupt erinnern, wann das eine und wann das andere durchzuführen ist). Sofortmaßnahmenkurse, wie sie heute durchgeführt werden schüren eher Ängste vor dem Helfen, als daß sie dazu ermutigen. Sie befassen sich zu sehr mit notfallmedizinischen Details, welche in einer tatsächlichen Notfallsituation weder erinnert werden, noch zu einer stärkeren subjektiven Sicherheit beim leisten von Erster Hilfe beitragen.Die Arbeit befasst sich also mit der schwierigen Situation, in welcher sich Autofahrer befinden, wenn sie einen Unfall beobachten und wie sie in der landläufigen Praxis der Erste-Hilfe-Ausbildung darauf vorbereitet werden. Die meisten Verkehrsteilnehmer fohlen sich nicht in der Lage, adäquat Hilfe zu leisten und können die notwendige schnelle Reaktion des Anhaltens aufgrund sozialpsychologisch fundierter Rahmenbedingungen nicht durchfuhren - was dann zum weithin bekannten Phänomen der Unterlassenen Hilfeleistung im Straßenverkehr fuhrt.Die Untersuchung zeigt, wie ein Unterricht in Lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort gestaltet sein muß, um dem entgegenwirken zu können. Gemessen wurden Einstellungswerte zur Hilfeleistung in Selbst- und Fremdeinschätzung nach Absolvierung des Kurses. Zwei grundsätzlich unterschiedliche Kursmodelle wurden an verschiedenen Orten Deutschlands durchgeführt ein medizinisch orientiertes Modell im Frontalunterricht und ein auf psychologische Variablen fokussierendes Modell mit pädagogisch fundierter Kursführung. Das psychologische Modell erwies sich gegenüber dem medizinisch orientierten Modell als hochüberlegen. Die Teilnehmer konnten die psychologischen Inhalte auf den Straßenverkehr übertragen und zeigten eine hohe subjektiv empfundene S. 84 pp. Deutsch.
-
IAS 39 - Accounting for Financial Instruments
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683285ISBN 13: 9783838683287
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diploma Thesis from the year 2004 in the subject Business economics - Accounting and Taxes, grade: 1,0, Reutlingen University (ESB), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Abstract:Financial markets have developed extremely in volume and complexity in the last 20 years. International investments are booming, due to the general relaxation of capital controls and the increasing demand of international diversification by investors. Driven by these developments the use and variety of financial instruments has grown enormously. Risk management strategies that are crucial to business success can no longer be executed without the use of derivative instruments.Accounting standards have not kept pace with the dynamic development of financial markets and instruments. Concerns about proper accounting regulations for financial instruments, especially derivatives, have been sharpened by the publicity surrounding large derivative-instrument losses at several companies. Incidences like the breakdown of the Barings Bank and huge losses by the German Metallgesellschaft have captured the public s attention. One of the standard setters greatest challenges is to develop principles applicable to the full range of financial instruments and implement structures that will adapt to new products that will continue to develop.Considering these aspects, the focus of this paper is to illustrate how financial instruments are accounted for under the regulations of the International Accounting Standard (IAS) 39. It refers to the latest version, Revised IAS 39 , which was issued in December 2003 and has to be applied for the annual reporting period beginning on or after January 1. 2005. First, the general regulations of this standard are demonstrated followed by special hedge accounting regulations. An overall conclusion that points out critical issues of IAS 39 is provided at the end of the paper. IAS 39 is highly complex and one of the most criticized International Financial Reporting Standards (IFRS). In many cases, the adoption of IAS 39 will lead to significant changes compared to former accounting regulations applied. Therefore the paper is designed to provide a broad understanding of the standard and to facilitate its implementation.Inhaltsverzeichnis:Table of Contents:Executive Summary11.Scope22.Financial Instruments - General Definitions and Regulations42.1Overview42.2Financial Assets42.3Financial Liabilities52.4Five Categories of Financial Instruments52.4.1Financial Assets and Liabilities at Fair Value through Profit or Loss62.4.2Held-to-Maturity Investment Assets72.4.3Loans and Receivables102.4.4Available-for-Sale Financial Assets102.5Offsetting of Financial Assets and Liabilities112.6Equity Instruments122.7Differentiation between Equity and Liabilities122.7.1Compound Equity and Liability Instruments142.8Derivatives152.8.1Overview152.8.2Derivatives under IAS 39162.8.3Embedded Derivatives173.Initial Recognition and Measurement213.1Initial Recognition213.1.1Trade Date versus Settlement Date223.2Initial Measurement223.2.1Fair Value223.2.2Transaction costs244.Subsequent Measurement254.1Fair Value versus Amortized Cost254.2Financial assets at Fair Value274.3Financial Assets excluded from Fair Valuation284.3.1Amortized Cost and Effective Interest Method284.4Impairment294.4.1Impairment of Financial Assets Carried at Amortized Cost or Cost314.4.2Impairment of Available-for-Sale Asset314.5Financial Liabilities325.Derecognition335.1Derecognition of Financial Assets335.1.1Gains and Losses on Derecognition Date335.1.2Recording based on Continuing Involvement345.2Derecognition of Financial Liabilities. 92 pp. Englisch.
-
A Literature Review on the Impact of Investment in Human Capital on Economic Success
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 383868365XISBN 13: 9783838683652
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Master's Thesis from the year 2004 in the subject Business economics - Operations Research, grade: 1,0, LMU Munich (Psychologie und Pädagogik), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Abstract:Champions of Human Capital in organisations, such as Human Resources directors, are in need of empirical evidence to justify to board members, CEOs and ultimately shareholders why financial investments into Human Capital should be increased or at least maintained. The research questions posed in this thesis take on the challenge to find empirical evidence that investment in Human Capital, through Human Resources, has a positive impact on intermediate as well as accounting and share-value indicators of organisational performance.This literature review summarises, integrates and evaluates research published between 1998 and 2003 pertaining to the direct and indirect relationship between Human Resources on different indicators of intermediate and bottom-line performance. The review is comprised of 31 articles clustered into the following topics: strategic HRM, Human Resources Development, technology, diverse workforces and flexible working conditions and methodological issues in HR-organisational performance research.Evidence for the direct and indirect impact of HR on organisational performance is discussed and the findings are interpreted with reference to Ostroff and Bowen s Multi-Level Model (2000), which explains the individual, organisational and inter-level relationships between Human Resources and organisational performance. Enabling conditions that strengthen the HR-organisational performance relationship are identified. Methodological issues such as levels of analyses, short-term vs. long-term perspectives and generalisability are evaluated in detail.Employee benefits from enhanced organisational performance and barriers to the diffusion of high-performance work practices are research questions that still remain unanswered (Ichniowski et al., 2000). Future research should focus on building up a portfolio of studies at different levels of analyses and include a broader range of organisational performance variables that are also relevant employees as well as shareholders and top management. The implications of the research findings for HR directors and corporate strategy functions are presented.Inhaltsverzeichnis:Table of Contents:1.Introduction42.Theoretical Background72.1How is Human Capital Conceptualised in the Management Literature 72.2The Human Capital Project82.3The Story so Far: Theoretical Perspectives on Human Resources Management92.3.1Current State of Research on HR Practices and Firm Performance92.3.2Four Theoretical Perspectives Explaining why Human Resources Practices matter for Organisational Performance112.3.3Multi-Level Model Linking HR Systems to Organisational Performance142.4Methodological Issues182.5Research Questions213.Method224.Results264.1Strategic HRM274.1.1HR Orientation274.1.2HRM Effectiveness and Business Strategy294.1.3Best Practice and Strategic Fit Models of HRM304.1.4High Involvement Work Practices in South Korean Culture334.1.5Quality Enhancer Strategy: Total Quality Management374.1.6Total Quality Management and Downsizing394.1.7Labour Market Flexibility414.1.8Role of HRM and Perception of Top Management444.1.9Presence of an HR Executive on the Board and Growth rate464.1.10HRM Practices and Work Climate474.1.11Synthesis of Findings on Strategic HRM and Contingency Variables504.2Human Resources Development534.2.1Training Effectiveness: Horizontal and Vertical Transfer534.2.2Financial Analysis of HRD544.2.3Company and Individual Returns to Investment in Education564.2.4Alignment of Training with Corporate Strategy574.2.5Align. 148 pp. Englisch.
-
Unternehmensführung in Inflationsländern
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683757ISBN 13: 9783838683751
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,7, Fachhochschule Düsseldorf (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Problemstellung:Inflation ist ein bedeutsames volkswirtschaftliches Phänomen, welches von den Wirtschaftssubjekten in der Regel unterschiedlich stark wahrgenommen wird. Obwohl oder gerade weil die Wirtschaftssubjekte eine Inflation unterschiedlich beurteilen und wahrnehmen, ergeben sich aus diesem Zusammenhang beträchtliche Konsequenzen. Diese Konsequenzen können abhängig vom betrachteten Wirtschaftssubjekt allerdings voneinander abweichen. Haushalte nehmen eine Inflation in der Regel als etwas Negatives wahr; die Kaufkraft scheint in der Höhe der Inflationsrate zu schwinden ,ohne dass etwas dagegen getan werden könnte oder ein Ausgleich diesen Verlust kompensiert. Bei Unternehmen kann es zu Beeinträchtigungen des Rechnungswesens führen und es müssen Wege gefunden werden, um betriebswirtschaftliche Abläufe und Größen auch bei Inflation planen und kontrollieren zu können.Beachtet werden muss allerdings, dass Inflation eine Erscheinung ist, die sich an keinen geregelten Ablauf hält; sie kann je nach Ursache und der Reaktion der Wirtschaftssubjekte sehr unterschiedlich ausfallen. Tangierte Wirtschaftssubjekte sind beispielsweise Unternehmen, die in Inflationsländern heimisch sind und so den Konsequenzen einer Inflation ausgesetzt sind.Weiterhin kann die Inflation Unternehmen betreffen, welche vermehrt international aktiv sind und in verschiedenen Ländern der Welt die makroökonomischen Gegebenheiten als externe, nicht zu beeinflussende Variablen, hinnehmen müssen. Ein solches Unternehmen ist beispielsweise die Daimler-Chrysler AG, welche im Jahr 2003 insgesamt 93 Produktionsstätten in 17 Ländern betrieb.Ursache für die zunehmende Internationalisierung von Unternehmen ist unter anderem die Mitte des 20ten Jahrhunderts verstärkt begonnene wirtschaftliche Liberalisierung. Ausgangspunkt dieser Entwicklung waren die von den britischen Nationalökonomen Adam Smith (1723- 1790) und David Ricardo (1772 1823) systematisch entwickelten Theorien des Wirtschaftsliberalismus, der Arbeitsteilung und des Freihandels, mit welchen der Protektionismus auch größtenteils in der Praxis überwunden werden konnten.Einen besonderen Anteil an dieser Entwicklung, welche seit den 1990er Jahren vermehrt mit dem Schlagwort Globalisierung versehen wird, hatten die nach dem zweiten Weltkrieg geschaffenen Institutionen und Abkommen.1944 wurden in Bretton Woods (New Hampshire, USA) der internationale Währungsfond und die Weltbank geschaffen; ersterer soll den Welthandel und die internationalen Währungsbeziehungen stabilisieren. Die Weltbank hingegen ist eine internationale Institution zur multilateralen Entwicklungshilfe, deren Hauptaufgabe die Vergabe von Krediten an Entwicklungsländer ist.Des Weiteren wurde im Jahre 1948 das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT General Agreement on Tariffs and Trade) in Kraft gesetzt, in dessen Rahmen in acht Zollsenkungsrunden die mengenmäßigen Handelsbeschränkungen weitgehend, die tarifären Handelshemmnisse zu wesentlichen Teilen beseitigt wurden.Nachfolgerin der GATT wurde 1995 die WTO (World Trade Organisation) welche nicht mehr ausschließlich den Handel mit Gütern regelt, sondern nun auch Dienstleistungen, Urheberrechte und Regelungen zu Direktinvestitionen in multilaterale Abkommen fasst.Im Zuge dieser Entwicklungen hat die Bedeutung von Unternehmen, die nicht nur im Außenhandel tätig sind, sondern auch jenseits ihrer nationalen Grenzen Waren produzieren und Dienstleistungen erbringen, stark zugenommen. Die Zahl solcher Unternehmen, die man als multinationale oder auch transnationale Unternehmen bezeichnet, ist seit 1990 erheblich angestiegen; waren es damals noch circa 7000, so existieren mittlerwei. 112 pp. Deutsch.
-
Rechtssicherheit bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen nach Änderung der Durchführungsvorschriften durch die VO 1/2003
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683404ISBN 13: 9783838683409
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,0, Hochschule Anhalt - Standort Bernburg (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Mit dem In-Kraft-Treten der neuen Durchführungsverordnung für Kartellverfahren, die VO 1/2003, hat die Europäische Gemeinschaft die bisher umfangreichste und tief greifendste Veränderung im Europäischen Wettbewerbsrecht realisiert.Schrifttum und Praxis bemängelten das sinkende Maß an Rechtssicherheit für Unternehmen, welches insbesondere für die risikoreichen FuE-Vereinbarungen besteht. Hervorgerufen wird Rechtsunsicherheit sowohl durch die nunmehr zu praktizierende Selbstveranlagung als auch durch die dezentrale Anwendung der Wettbewerbsregeln. Im Rahmen der Diplomarbeit werden diese Probleme aufgegriffen und Lösungsansätze diskutiert.Im ersten Hauptteil der Arbeit werden Instrumente hinsichtlich Inhalt und Rechtsverbindlichkeit untersucht, anhand derer eine Beurteilung von FuE-Kooperation erleichtert werden soll. Insbesondere wird auf die umstrittene Stellung der Gruppenfreistellungsverordnungen eingegangen und gezeigt, dass diesen auch weiterhin eine bindende Wirkung zukommt.Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit der Dezentralisierung. Dabei wird die Anwendung der Wettbewerbsregeln durch nationale Behörden und Gerichte analysiert. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die neue Verfahrensverordnung und die Bekanntmachungen insgesamt gute Lösungsansätze bieten, eine uneinheitliche Anwendung des Art. 81 EG zu unterbinden. Dennoch wird auch auf Problempunkte eingegangen, die im Einzelfall auftreten können.Abschleißend wird auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Untersuchung ein Leitfaden zur kartellrechtlichen Beurteilung von FuE-Kooperationen erstellt.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsübersichtiInhaltsverzeichnisi iAbkürzungsverzeichnisviiA.Einleitung1I.Einführung1II.Gang der Untersuchung2B.Art. 81 EG im Lichte der Kartellverfahrensreform3I.Art. 81 EG unter VO 17/6231.Das Verbotssystem mit Erlaubnisvorbehalt32.Verfahren vor der Kommission3II.Art. 81 EG unter der neuen Verfahrensvorschrift VO 1/200351.Notwendigkeit und Intention der Reform52.Legalausnahmeprinzip63.Dezentralisierung7a.Nationale Wettbewerbsbehörden8b.Nationale Gerichte84.Sonstige Regelungen der VO 1/20039III.Zusammenfassung9C.FuE-Kooperationen aus ökonomischer und wettbewerbsrechtlicher Sicht11I.Ökonomische Beurteilung von FuE-Kooperationen111.Forschung und Entwicklung als Wettbewerbsfaktor112.Kooperationen in Forschung und Entwicklung12a.Beweggründe und Formen12b.Nebenabreden13c.Vor- und Nachteile der gemeinsamen Forschung und Entwicklung15aa.Vorteile15bb.Nachteile173.Aufgaben des Kartellrechts18II.FuE-Kooperationen aus wettbewerbsrechtlicher Sicht181.Zielkonflikt182.Lösungsansatz19III.Zusammenfassung20D.Rechtssicherheit bei Kooperationen in Forschung und Entwicklung21I.Problemstellung und Abgrenzung zu anderen Kooperationen21II.Beurteilung anhand von Gruppenfreistellungsverordnungen221.GVOen im Anmelde- und Genehmigungssystem22a.Rechtsgrundlagen22b.Rechtliche Wirkung232.GVOen im System der Legalausnahme24a.Intention der VO 1/200324b.Verbindlichkeit von Gruppenfreistellungsverordnungen25aa.Standpunkt der deklaratorischen Wirkung25(1)Deklaratorische Wirkung aufgrund des Legalausnahmesystems25(2)Fehlende Rechtsgrundlage für GVOen26(3)GVOen als unwiderlegbare Vermutung26bb.Standpunkt der konstitutiven Wirkung26(1)Trennung von Einzel- und Gruppenfreistellung27(2)Ermächtigung. 128 pp. Deutsch.
-
Entwicklung von Beurteilungsmaßstäben für strategische Unternehmenskooperationen
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3832483071ISBN 13: 9783832483074
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Fachbuch aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 2,3, Hochschule Offenburg (Technische Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Das 20. Jahrhundert wird zunehmend durch ökonomische Turbulenzen und Verunsicherungen bestimmt. Die Globalisierung der Weltmärkte, verkürzte Produktlebenszyklen, dynamische Märkte sowie die immer noch anhaltende Wirtschaftsflaute sind ständig zitierte Probleme und Kräfte, die auf die einzelnen Unternehmen einwirken. Ebenso bringt die am 1. Mai 2004 vollzogene EU-Osterweiterung zusätzliche Chancen und Risiken für Unternehmen der bisherigen sowie der neuen Mitgliedsstaaten mit sich. Diese erwähnten Evolutionen zwingen die Unternehmen zur Entwicklung neuer Strategien.Zunehmende Wissensintensität, schnellere Innovationen, höhere Qualitätsstandards und immer kürzere Produktlebenszyklen treiben viele Unternehmen an die Grenzen des Machbaren. Auch die Komplexität im gesamten Wertschöpfungsbereich nimmt zu. In Folge dessen schrumpft das Ausmaß, welches eine Firma alleine bewältigen kann, kontinuierlich. Daher wird es immer wichtiger, dass sich Unternehmen auf ausgewählte Aktivitäten und Kompetenzen konzentrieren, mit denen sie nachhaltig Wettbewerbsvorteile bzw. Erfolgspositionen aufbauen können.Als Bilanz der obigen Überlegungen ergibt sich die Erfordernis bestehende Strategien und klassische Unternehmensstrukturen neu zu überdenken. Einstige Managementprinzipien und der altbewährte Alleingang müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Als Alternative zur Bewältigung der oben genannten Komplexitäten praktizieren viele Unternehmen seit geraumer Zeit unterschiedliche Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit. Das Denken in klar definierten Unternehmensgrenzen gehört bei Betrieben der Zukunft nicht mehr zum Unternehmensleitbild. Vielmehr muss die Offenheit zu Neuem gestärkt werden, insbesondere bei der Veränderung bestehender Strukturen.Prozesse, die ein anderes Unternehmen effizienter als das eigene durchführen kann, sollten nicht um jeden Preis selbst realisiert werden. Wenn Ziele durch ein anderes Unternehmen schneller, kostengünstiger und mit geringerem Risiko erreicht werden können, sollte in jedem Fall über eine Zusammenarbeit nachgedacht werden. Vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, aber auch in vielen anderen Zweigen haben sich die Anforderungen drastisch geändert. Der Eingang einer Kooperation bedeutet noch lange nicht den Verlust der eigenen Selbstständigkeit. Vielmehr sollten die positiven Gesichtspunkte, die sich z.B. durch Ressourcenbündelungen abzeichnen, in den Vordergrund gestellt werden. Damit können eigene Defizite ausgeglichen werden und sich zugleich für die beteiligten Betriebe Lerneffekte ergeben.Mit der Gründung einer Kooperation verfolgen die Unternehmen die unterschiedlichsten Motive und Motivationen. Einige versuchen durch das Zusammenwirken ein zweites Standbein aufzubauen, andere wiederum erhoffen sich mit der Kooperation Wettbewerbsvorteile oder auch den Zugang zu neuen Technologien. Der Eintritt in neue Märkte, den Know-how-Zuwachs oder auch bestimmte Synergieeffekte dürfen ebenfalls als Motivationsgründe nicht außer Acht gelassen werden.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisV1.Einleitung11.1Zielse tzung der Arbeit21.2Aufbau der Arbeit22.Grundlagen und begriffliche Abgrenzungen32.1Einordnung der Unternehmenskooperation32.1.1Wodurch zeichnen sich Kooperationen aus 42.1.2Chancen und Ziele einer Kooperation42.1.3Risiken und Nachteile einer Kooperation72.1.4Kooperationsfördernde bzw. -hemmende Faktoren112.2Verschiedene Arten der Zusammenarbeit122.2.1Horizontale Verbindungen132.2.2Vertikale Verbindungen132.2.3Konglomerate Verbindu. 112 pp. Deutsch.
-
Vertrauensbildende Maßnahmen in web-basierten Beratungssituationen
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683129ISBN 13: 9783838683126
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,0, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Die Analyse von Erfolgsfaktoren bzw. Hemmnissen der Akzeptanz von Electronic Commerce Angeboten im Internet führt u.a. zum Phänomen des mangelnden Vertrauens des Kunden in E-Commerce Anbieter sowie auch in das Internet als Medium im Allgemeinen.Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Angebots von über das Internet vertriebenen Produkten und Dienstleistungen kommt der Beratung des Kunden im Vorfeld eines Online-Vertragsabschlusses und im Rahmen eines effektiven After-Sales-Services eine ansteigende Bedeutung zu. Web-basierte Beratungsleistungen tragen in diesem Zusammenhang erheblich zur Akzeptanz von E-Commerce Angeboten und der Adoption des Internet als Transaktionsmedium bei. Eine essentielle Notwendigkeit für das erfolgreiche Durchführen web-basierter Beratungssituationen ist das Vorherrschen einer Vertrauenssituation. Diese Arbeit analysiert das Vertrauenskonstrukt aus einer interdisziplinären Sichtweise und leitet darauf aufbauend vertrauenskonstituierende Maßnahmen für zuvor spezifizierte Online-Beratungssituationen ab.Gang der Untersuchung:Nach einer kurzen Einführung, in der Motivation, Ziel und der Gang der Untersuchung skizziert werden, baut sich die Arbeit in fünf Hauptteilen auf.Zunächst wird in Kapitel 2 eine ausführliche Betrachtung des Vertrauenskonstrukts aus der Perspektive von verschiedenen Wissenschaftszweigen vorgenommen. Dabei wird bewusst auf die Unterschiede der jeweiligen Vertrauensverständnisse vor dem Hintergrund der originären Erkenntnisinteressen der betrachteten Disziplinen eingegangen, um abschließend die gewonnen Ergebnisse in einem integrierenden allgemeinen Modell des Vertrauensbildungsprozesses zu vereinen.Anschließend erfolgt eine Analyse der elementaren Bestandteile und Charakteristika von Beratungsleistungen, wobei deren besondere Relevanz in Kaufentscheidungsprozessen hervorgehoben wird. Die web-basierte Beratungsleistung als spezielle Form der Beratung wird bzgl. ihrer speziellen Merkmale durchleuchtet. Eine weitere Abgrenzung zu ähnlichen Informationsbeschaffungsmaßnahmen im Internet wird durchgeführt und schließlich die Einordnung in den Customer Buying Cycle vollzogen.Es folgt die Zusammenführung der Ergebnisse der ersten beiden Teile in einer Positionierung von Vertrauen als generellem Erfolgsfaktor im Electronic Commerce, sowie als speziellem Erfolgsfaktor von web-basierten Beratungsleistungen. Auf der Maßnahmenebene wird eine Begriffsbestimmung von vertrauensbildenden Maßnahmen vorgenommen und die Beratung als spezielles Anwendungsszenario identifiziert.Der abschließende Teil der Arbeit wendet das zuvor erarbeitete Modell des Vertrauensbildungsprozesses auf die bei einer Inanspruchnahme von web-basierten Beratungsleistungen gegebene spezielle Vertrauenssituation an und ordnet den einzelnen Bestandteilen des Modells potenziell vertrauensbildende Maßnahmen zu. Dadurch wird ein bloßes Gegenüberstellen von Maßnahmen vermieden, so dass die Wirkungsrichtung und voraussichtliche Effizienz einzelner Maßnahmen vor einem fundierten theoretischen Hintergrund bestimmt werden kann. Es wird aus Sicht der interdisziplinären Vertrauensforschung einem ganzheitlichen Vertrauensmanagement von beratungsintensiven E-Commerce Angeboten zugearbeitet.Die ausführliche Betrachtung des Vertrauenskonstrukts in Kapitel 2, bei der Erkenntnisse der Soziologie, der Sozialpsychologie, der Kommunikationswissenschaften und innerhalb der Wirtschaftswissenschaften der Neuen Institutionenökonomik und verschiedenen Bereichen des Marketing einfließen, kumuliert in der Formulierung eines allgemeinen Modells des Vertrauensbildungsprozesses. Die einzelnen Bestandteile des Modells sind. 136 pp. Deutsch.
-
CFD-Simulation des Strömungsfelds im T-Mischer mit anschließender Fluidbahnberechnung nach dem Lagrange-Ansatz
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683358ISBN 13: 9783838683355
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Maschinenbau, Note: 1,0, Technische Universität München (unbekannt), Veranstaltung: Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Rahmen dieser Semesterarbeit wurde sowohl das Strömungsfeld als auch der Verlauf repräsentativer Fluidbahnen nach dem Ansatz von Lagrange in einem T-Mischer simuliert. Dabei wurde das CFD-Software-Packet CFX-4.4 verwendet. Hintergrund ist die Erweiterung eines Modells zur Berechnung der Partikelgrößenverteilung über Populationsbilanzen. Ist im bisherigen Modell der Leistungseintrag und der Volumenanteil als konstant über das Mischervolumen angenommen, so soll im neuen Modell der Einfluss der Abhängigkeit des Leistungseintrags vom Ort als auch das bisher vernachlässigte Makromischen berücksichtigt werden. Die untersuchten Volumenströme reichen von 0,2ml/s bis 10ml/s. Zur Berechnung des Strömungsfeldes wurde ein low Reynolds number k-epsilon-Modell verwendet, da es als einziges Modell die Vorgaben für den y-plus-Wert, in Verbindung mit einer sinnvollen Gitterstruktur, erfüllt. Während man im unteren Bereich die Rechnungsdaten der Strömungsfeldsimulation sehr gut mit gemessenen Druckverlustwerten validieren kann, weichen sie im oberen Bereich um ca. 30% von den Messwerten ab. Der Grund für dieses Abweichen sind evtl. die Vorgaben für den Richtwert y-plus. Sie können für hohe Volumenströme nicht mehr exakt erfüllt werden, da das verwendete Turbulenzmodell hier an seine Grenzen stößt.Neben der Bestätigung der Simulationsergebnisse durch Validierung der y-plus-Werte und dem Vergleich der berechneten mit den experimentellen Druckverlustwerten, sowie durch konvergente Residuenverläufe erfüllen die Simulationsergebnisse auch die Bedingungen der Symmetrieerhaltung. Sie belegen für alle Volumenströme die Ausbildung eines Strudels im oberen Teil des Mischer. Der spezifische Leistungseintrag tritt an den Stellen mit größter Scherung, dort wo das zuströmende Fluid auf den Strudel trifft, auf.Die erhaltenen Strömungsfelder sind die Grundlage der nachgeschalteten Fluidbahnberechnung. Hierbei werden mit einem Modell für masselose Partikel Fluidbahnen berechnet und die relevanten Strömungsgrößen entlang dieser Bahnen ausgegeben. Zur Berücksichtigung turbulenter Schwankungen der Strömung und damit unterschiedlicher Bahnen bei gleicher Startposition wurde das Modell TURBULENT DISPERSION eingesetzt. Die Verläufe der Strömungsgrößen epsilon und VOLUMENANTEIL entlang der berechneten Fluidelementbahnen unterscheiden sich daher von Bahn zu Bahn deutlich, so dass eine deutliche Verbesserung der Simulation der Partikelgrößenverteilung erwartet werden darf.Nach einem einleitendenden theoretischen Teil über die Beschreibung turbulenter Strömungen im Allgemeinen wird auf die Geometrieerzeugung, die Erzeugung und den Umgang des in CFX-4.4 notwendigen COMMAND-FILEs und der einzelnen USER FORTRAN Routinen eingegangen. Danach wird sich mit der Wahl des Turbulenzmodells, welche für jegliches Strömungsproblem einen kritischen Punkt darstellt, auseinandergesetzt, und die oft damit verbundene Anpassung des Gitternetzes behandelt. Inhalt des letzten Kapitels ist die Berechnung der Fluidbahnen und die in CFX-4.4 mehr oder weniger diffizile Ausgabe abhängig von ihrer Art der Strömungsgrößen entlang der Fluidbahnen. Das verwendete COMMAND-FILE sowie die entsprechenden USER FORTRAN Routinen werden ausführlich besprochen und ihre Anwendung anschaulich dokumentiert.Keywords: CFD T-Mischer; y-plus-Wert; RS-Modell; low Reynolds number k-epsilon-Modell; Partikelbahnen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung52.Beschreibun g turbulenter Strömungen72.1Navier-Stockes Gleichungen72.2Turbulenzmodelle in CFX-4.482.3Wandbehandlung103.Strömu. 100 pp. Deutsch.
-
Dynamic Packaging
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683595ISBN 13: 9783838683591
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Touristik / Tourismus, Note: 1,2, Technische Universität Dresden (Verkehrswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:In der Diplomarbeit wird mit dem Dynamic Packaging ein aktuelles Thema bearbeitet, welches gegenwärtig die Tourismusindustrie umkrempelt. Der Terminus-Technikus Dynamic Packaging erschien erstmals 1996 in der Fachliteratur. Die damals angeregte, stärker kundenorientierte Bündelung von Reisepaketen war jedoch vorerst lange Zeit kein Gesprächsthema mehr. Im Zuge einer durch interne und externe Einflüsse verursachten Krise der Tourismuswirtschaft in den letzten Jahren wurde über neue erfolgversprechende Lösungsansätze für die Veranstalter-Reisen nachgedacht und die Idee des Dynamic Packaging wieder aufgegriffen. Wichtige Impulse für die technische Umsetzung kamen dabei auch durch die breite Diffusion des Internets zum Ende der 1990er Jahre.Der Ansatz des Dynamic Packaging liegt in der Absicht den Reisenden ein Reisepaket von der Art einer Pauschalreise selbst zusammenstellen zu lassen. Dem Reisenden werden individuell kombinierbare Reiseleistungen zur Wahl gestellt, aus denen er sich die Gewünschten auswählt und zu einem Leistungspaket zusammenschnürt. Die Zusammenstellung erfolgt unter Einschaltung des Internet als Koordinationsmedium zwischen dem dynamisch Packenden und den Leistungsträgern.Die vorliegende Diplomarbeit beleuchtet das Dynamic Packaging in vier Kapiteln:Kapitel 2 beginnt mit der Darstellung der allgemeinen Tourismuswirtschaft und beschäftigt sich mit den Entstehungsgründen des Dynamic Packaging. So werden die äußeren tourismuswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ein sich veränderndes Verbraucherverhalten analysiert. Diese werden im Anschluss als Erklärungsgründe auf die Entstehung und Veränderung der Paketreisen übertragen.Das Dynamic Packaging wird im Kapitel 3 definiert und als neue Angebotsform von Paketreisen vorgestellt. Die Veränderungen, welche diese neue Angebotsform auf das Selbstverständnis der einzelnen touristischen Nachfrager und Anbieter hat, werden ausführlich beleuchtet.Das Dynamic Packaging bietet für alle an der Tourismuswirtschaft Beteiligten Chancen und Risiken. Kapitel 4 betrachtet dazu zuerst die Branchenstruktur der Tourismuswirtschaft, zeigt dafür den Status Quo und mögliche neue Ausprägungen auf. Als Erklärungsgrundlage werden dafür die Wertschöpfungskette nach Porter und die Transaktionskostentheorie herangezogen. Letztere gibt Aufschluss über Auswirkungen des Dynamic Packaging auf die Tourismuswirtschaft, was durch die Konzepte der Intermediation, Disintermediation und Reintermediation begründet wird.Ergänzend werden in Kapitel 5 für das Dynamic Packaging relevante preis- und produktpolitische Instrumente beleuchtet und auf ihre Praktikabilität hin analysiert und bewertet. Aufgrund der definitorischen Implikationen des Dynamic Packaging werden erste Handlungsstrategien für die Tourismuswirtschaft erläutert.Ein ausführliches Fazit rundet die Arbeit ab.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:INHALTSVERZEICHNISIABBILDUNGSVERZEICHNI SIVTABELLENVERZEICHNISVIABKÜRZUNGSVERZEICHNISVIIANHANGVERZEI CHNISVIII1.Einleitung11.1Zielsetzung11.2Vorgehensweise12.Tou rismuswirtschaft und touristische Nachfrage im Wandel32.1Die Tourismuswirtschaft32.2Veränderte Rahmenbedingungen in der Tourismuswirtschaft72.3Verändertes Reiseverhalten92.4Paketreisen132.4.1Pauschalreisen132.4.2Bausteinreisen173.Dynamic Packaging als neue Angebotsform193.1Definition und Abgrenzung193.2Sichtweisen des Dynamic Packaging273.2.1Die Sicht der Nachfrager touristischer Leistungen273.2.2Die Sicht der Anbieter touristischer Leistungen293.2.2.1Leistungsträger293.2.2. 148 pp. Deutsch.
-
Die nichtlineare Erzählstruktur des postmodernen Films am Beispiel "Mulholland Drive" von David Lynch
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 383868320XISBN 13: 9783838683201
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Kunst - Fotografie und Film, Note: 2,2, Technische Universität Ilmenau (Mathematik und Naturwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Die vorliegende Arbeit untersucht die Filmnarration des (post)modernen Kinos. Besonderes Augenmerk liegt auf der unkonventionellen Erzählstruktur, die entgegen dem klassischen Hollywoodkino vorgeht. Die Filmanalyse (Hauptteil) beschäftigt sich näher mit David Lynchs Mulholland Drive und belegt inwieweit dieser Film postmodern ist.Theoretisch und mit Beispielen aus der Filmgeschichte wird im ersten Teil eine Abgrenzung zwischen dem modernen und postmodernen Film vorgenommen. Der moderne Film wird charakterisiert. Vorgehensweisen gegen das konventionelle Hollywoodkino werden erörtert. Nähergebracht wird dies durch verschiedene Beispiele, u.a. durch Sergej M. Eisensteins Ästhetik der Grossaufnahme, die Auflösung der Filmnarration bei Luis Bunuel oder Maya Derens Auflösung von Zeit und Raum zugunsten einer flüssigen Bewegung. Weiter wird die französische Nouvelle Vague besprochen.Demgegenüber wird der postmoderne Film, von mir als Reflektion auf die Medienwelt verstanden, näher analysiert. Anhand mehrerer Kriterien wird die Abgrenzung vom modernen Kino beschrieben. Definiert von mir sind folgende Merkmale eines postmodernen Films:- Postmodernes Kino als Medienreflexion.- Die Doppelcodierung.- Die fragmentierte Struktur des postmodernen Films.- Die Künstlichkeit des Dargestellten.- Überwältigung der Sinne.- Autonomie der synästhetischen Reize oder Hierarchieschwund.Diese Kriterien werden im Hauptteil auf das Werk von David Lynch übertragen. Auf die Frage, ob Mulholland Drive ein postmoderner Film ist, wird unter Einbezug anderer Filme Lynchs detailliert eingegangen. Neben biographischen und filmographischen Daten zu David Lynch ermöglicht uns die Filmanalyse näher in das Spektrum dieses surrealen Films einzutauchen, denn Verweise zur Nichtlinearität finden sich im gesamten Filmtext. Lynchsche Codierungen werden mit Beispielen erläutert und die Ähnlichkeit zwischen der Traum- und der Filmerzählung werden anhand einiger Kriterien auf Mulholland Drive übertragen. Dieses Wissen macht eine Deutung des Films mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich. Letztendlich ist diese Arbeit eine Reise in die Filmgeschichte, die (Post)moderne und in die unterbewussten und surrealen Welten des Filmemachers David Lynchs.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Zusammenfassung1Inhaltsverzeic hnis21.Der postmoderne Film51.1Merkmale des postmodernen Films61.1.1Postmodernes Kino - Eine Medienreflexion61.1.2Die Doppelcodierung71.1.3Die fragmentierte Struktur des Postmodernen Films101.1.4Die Künstlichkeit des Dargestellten111.1.5Überwältigung der Sinne131.1.6Autonomie der synästhetischen Reize oder Hierarchieschwund151.2Der Film der Moderne161.2.1Die Avantgarde (der 20er Jahre) - Eine zeitliche Einordnung161.2.2Charakterisierung eines Films der Moderne171.2.4Die amerikanische Avantgarde als Erbe der Zwanziger211.2.5Die zweite Blüte des Europäischen Avantgardefilms221.2.5Das Neue des modernen Films231.2.6Der Niedergang der Moderne241.3Ist die Moderne von der Postmoderne abgrenzbar 251.3.1Postmoderne Moderne _ Gemeinsamkeiten271.3.2Unterschiedliche Vorstellungen291.3.3Ist die Postmoderne neu 302.Die Subversion des unkonventionellen Kinos312.1Nichtlineare Filme und ihr Umgang mit Zeit, Raum und Rezipienten312.1.1Neue Filmzeit322.1.2Neuer Filmraum352.1.3Ein veränderter Rezeptionsbegriff372.2Narrative Erzählstruktur versus (Post)moderne Erzählstruktur392.2.1Der klassische Filmaufbau und die regellose (Post)moderne. 168 pp. Deutsch.
-
Betriebliche Voraussetzungen organisationspädagogischer Konzepte
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683269ISBN 13: 9783838683263
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: 1,0, Bergische Universität Wuppertal (Erziehungswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Das forschungsleitende Interesse entwickelte sich zum einen aus der Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich rasant entwickeln und auch die Pädagogik sich heute dem Phänomen Organisation nicht mehr verschließen kann. Zum anderen kamen den Autorinnen bei der Auseinandersetzung mit bisherigen organisationspädagogischen Konzepten sehr schnell Zweifel bezüglich deren empirischer Fundierung. Es geht in diesen organisationspädagogischen Konzepten zudem meist um Lernen und die besondere Stellung des Individuums in der Organisation, wobei jedoch noch von einem traditionellen Bild des Beschäftigungsverhältnisses ausgegangen wird. Doch sollten die in den letzen Jahren stark zugenommenen prekären Beschäftigungsverhältnisse, in solchen Betrachtungen berücksichtigt werden. Die Pädagogik kann sollte bei der Beschäftigung mit Organisation nicht nur vom Normal-Beschäftigungsverhältnis ausgehen, sondern sollte den Blick nicht versperren für die aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Ebenfalls muss die Pädagogik die spezifischen Strukturen und Funktionsmechanismen der erwerbswirtschaftlichen Organisation berücksichtigen und darf nicht einfach ihre Erfahrungen aus pädagogischen Institutionen auf die erwerbswirtschaftlichen spiegeln.Durch den pädagogischen Blickwinkel erscheinen den Autorinnen zunächst die individuellen Voraussetzungen für Motivation und Zugehörigkeit im Rahmen der bereits erwähnten prekären Beschäftigungsverhältnisse von besonderer Bedeutung, wenn man organisationspädagogische Konzepte zeitgemäß und empirisch fundiert entwickeln möchte.Die Darstellung wird sich in einem ersten Schritt mit dem theoretischen Hintergrund, dabei im Besonderen mit dem Verhältnis von Organisation und Pädagogik, beschäftigen. Zunächst wird die historische Entwicklung der pädagogischen Betrachtung von Organisation im Bereich der betrieblichen Weiterbildung nachgezeichnet. Nach einer Abgrenzung der pädagogischen Betrachtungsweise von Organisationen zu ihren organisationswissenschaftlichen Nachbarwissenschaften, wird die Hinwendung der Pädagogik zum Phänomen der Organisation durch den so genannten Paradigmenwechsel in Wirtschaft und Gesellschaft begründet. Anschließend stellen die Autorinnen die Entstehung der Organisationspädagogik dar, welche sich aus der Diskussion um Organisationsentwicklung und Organisationslernen entwickelt hat und umreißen deren Grundannahmen.Dieser Debatte wird im Anschluss eine weitere pädagogische Position gegenübergestellt, um auf Schwachstellen organisationspädagogischer Konzepte hinzuweisen. In diesem Zusammenhang gehen die Autorinnen auf besondere Aspekte der allgemeinen Systemtheorie zur Entwicklung von Begrifflichkeiten, die der komplexen Realität von Organisation Rechnung tragen ein.Um sich dem Phänomen der Organisation weiter zu nähern, befassen sich die Autorinnen folgend mit der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Debatte zur Organisationstheorie. Sie nähern sich dem Begriff der Organisation und betrachten hier insbesondere die Faktoren Individuum und Arbeit. Historisch wird die Entwicklung der Organisationsdebatte unter besonderer Berücksichtigung des Faktors Mensch nachgezeichnet.Im dritten Kapitel erläutern die Autorinnen die methodologischen und methodischen Grundannahmen, auf denen diese Fallstudie beruht. Dies erfolgt durch die Begründung des gewählten qualitativen Forschungsdesigns sowie durch die Vorstellung der einzelnen eingesetzten Methoden, deren Vorgehensweise und der Begründung dieser Wahl.Im nächsten Schritt wenden sich die Autorinnen unserer empirischen Fallstudie zu, indem wir zunächst das Forschungsfeld näher beschreiben. Nach einer Beschreibung des. 160 pp. Deutsch.
-
The equal opportunity illusion: The effects of prejudice and power on information seeking, employee evaluation, task assignment, and estimates of employee success
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683803ISBN 13: 9783838683805
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diploma Thesis from the year 2003 in the subject Psychology - Social Psychology, grade: 2,0, University of Marburg (Psychologie), language: English, abstract: Inhaltsangabe:Abstract:This study tested the effects of individual variables (prejudice level) and situational factors (power instructions) on information seeking strategies, employee evaluation, estimation of likely success, and task assignment in an employer employee, ethnicity relevant experimental design, with subjects always assigned the role of employer and an ostensibly other person (a same gender black individual depicted in a photograph) assigned the role of employee. Subjects (N=60) were categorized into groups that varied on power (exclusive or inclusive leadership instruction) and prejudice (quartile split of MRS scores). Participants were asked to select a subset of questions and tasks from various lists for the ostensibly other subject to answer. Participants at a later point in the experiment rated selected questions and tasks. At the end of the experiment the participants were asked to give a final employee evaluation and estimation of likely success for a future project.Next to the attempt of replicating generally accepted and expected interrelations of power and prejudice with certain attention (information seeking) strategies and the use of stereotypes and their effect on evaluation and estimation, one of the main focuses of this study is on the effects of the above variables on behavior (final task assignment).Consistent with predictions participants with a low prejudice level assigned more valued tasks, focused more on strength of the employee and estimated greater employee success than did high prejudice participants. Also participants with inclusive leadership instructions assigned relatively more skill tests with supporting help and estimated greateremployee success than participants with exclusive leadership instructions. Interaction -effects across the skills test- information seeking-, employee evaluation-, final task assignment-, and estimated success- variables showed that high prejudiced participants in the exclusive leadership style condition respond in stereotype consistent ways significantly more often than participants in the inclusive leadership condition and low prejudice participants.Zusammenfassung:Diese Studie untersuchte den Einfluss individueller (Vorurteilslevel) und situationaler Faktoren (induzierter Machtstatus) auf Strategien der Informationssuche, der Bewertung eines Bewerbers in einer Bewerbungssituation, der Einschätzung von Erfolgschancen, sowie der Aufgabenverteilung. Das Untersuchungsdesign wurde als Arbeitgeber-Arbeitsnehmer Kontext mit ethnischer Relevanz konstruiert. Dabei wurde den Versuchspersonen immer in der Rolle des Arbeitgebers mit einer fingierten anderen Person als Arbeitnehmer (eine gleichgeschlechtliche Person mit afro-amerikanischer Herkunft, welche nur auf einem Foto sichtbar war) zugewiesen.Die Versuchpersonen (N=60) wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt, die sich hinsichtlich ihres Machtstatus (Instruktionen, die anwiesen den Arbeitnehmer auszuschließen oder mit einzubeziehen) sowie ihrer Vorurteilsausprägungen (Werte auf der modern racism scale ) unterschieden.Versuchpersonen wurden gebeten eine Auswahl von Fragen und Aufgaben aus verschiedenen Listen auszuwählen, die anschließende zur Bearbeitung dem Arbeitnehmer vorgelegt werden sollten.Später sollten die Versuchspersonen die Ihnen zurückgereichten Arbeitnehmer-Leistungen bewerten. Schließlich gaben die Versuchspersonen noch eine Bewertung des Arbeitnehmers ab, die eine Einschätzung der Erfolgschancen dieser Person bei einem zukünftigen Projekt beinhaltete.Neben dem Versuch einer Replikation allgemein akzeptierter Interkorrelationen zwischen Macht und Vorurteilen mit Strategien zur Informationssuche sowie Verwendung von Stereotypen, . 100 pp. Englisch.
-
EDV-gestützte Planung und Verwaltung heterogener technischer Netzwerkinfrastrukturen
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683501ISBN 13: 9783838683508
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 212 pp. Deutsch.
-
Web- und OLAP-basierte Controlling-Systeme
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683250ISBN 13: 9783838683256
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,0, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Organisation und Lernen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Ziel dieser Arbeit soll es sein, dem Leser die Vielgestaltigkeit möglicher Auswirkungen aufzuzeigen, welche mit der Einführung eines Web- und OLAP-basierten Controlling-Systems einhergehen (können). Dabei lässt sich die Arbeit in zwei große Blöcke gliedern:Block 1 Zunächst einmal werden wichtige Begriff wie E-Controlling , Web-Controlling usw. genau definiert und voneinander abgegrenzt. Dann folgt ein historischer Abriß über die Entwicklung von elektronischen Informationssystemen. Weiter geht es mit einer ausführlichen Beschreibung der Bausteine moderner Analytischer Informationssysteme (Data Warehouse, Business Intelligence Tool usw.). Daran anschließend wird dem Leser ein Ausblick auf zukünftige Trends und Entwicklungsperspektiven elektronischer Informationssysteme gegeben. Der Block schließt durch eine genaue Beschreibung der Spezfika Web- und OLAP-basierter Controllingsysteme. Die Ausführungen werden ergänzt durch die Miteinbeziehung eines praktischen Anwendungsbeispiels eines Web- und OLAP-basierten Controllingsystems in einem führenden Industrieunternehmen.Block 2 In diesem Block werden die Wirkungen von Web- und OLAP-basierten Controllingssystemen näher analysiert. Dabei stehen einmal die Wirkungen auf die Organisationsstruktur (z. B. Lean Controlling und Outsourcing) und einmal die sozialen Wirkungen auf die Menschen im Unternehmen (z. B. Verhältnis Controller und Manager) im Blickpunkt der Betrachtung. Auch dieser Block schließt mit einem praxisorientierten Abschnitt, einem Praxis-Leitfaden für die Einführung Web- und OLAP-basierter Controlling-Systeme.Wir hoffen, dass jeder Leser (sowohl Theoretiker als auch Praktiker) die von ihm gewünschten Informationen findet bzw. er in Bezug auf die Thematik, neue Perspektiven und Bezugspunkte gewinnen kann.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.VORWORT42.EINFÜHRUNG72.1METHODOLOGIE113.DEFINITION UND ABGRENZUNG WICHTIGER BEGRIFFE153.1E-CONTROLLING153.2E-BUSINESS163.3WEB-CONTROLLING173.4E-REPORTING184.TECHNISCHE GRUNDLAGEN194.1HISTORISCHE ENTWICKLUNG194.1.1Management-Informationssysteme204.1.2Entscheidungsunterstützungssysteme214.1.3Führun gs-Informationssysteme224.1.4Analytische-Informationssysteme 244.2DIE BASISKOMPONENTEN EINES ANALYTISCHEN-INFORMATIONSSYSTEMS264.2.1Data Warehouse264.2.2On-Line Analytical Processing304.2.3Data Mining354.2.4Business Intelligence Tool404.3TRENDS UND ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN414.3.1Web-Anbindung424.3.2Active Data Warehouse424.3.3Advanced Analytics434.3.4Knowledge Management434.4WEB- UND OLAP-BASIERTE CONTROLLING-SYSTEME435.ANWENDUNGSBEISPIEL495.1VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS495.2VORSTELLUNG DER SOFTWARE505.3DER ONLINE BUSINESS DESKTOP BEI DER GKN SINTER METALS555.4ABSCHLIEßENDE BEWERTUNG DER SOFTWARE606.WIRKUNGEN - ORGANISATIONSSTRUKTURELL636.1ZENTRALISIERUNG VS. DEZENTRALISIERUNG636.1.1Das Verhältnis zwischen zentralen und dezentralen Controllerstellen676.1.2Telekooperation und Dezentralisierung des Controllings726.2REORGANISATION UND BUSINESS PROCESS REENGINEERING796.2.1Veränderungen in der Unternehmensorganisation durch IuK806.2.2Das Virtuelle Unternehmen836.2.3Business Process Reengineering896.2.3.1Business Process Reengineering und IuK926.3OUTSOURCING956.3.1Outsourcing im Wandel976.3.2Erfolgsfaktoren und Risiken des Outsourcing986.3.3Pro & Contra des Outsourcing996.3.4Wirtsch. 188 pp. Deutsch.
-
Bilanzierung von Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen und die Konkretisierung durch den Interpretationsentwurf IFRIC D2
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683471ISBN 13: 9783838683478
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Energiewissenschaften, Note: 2,0, Technische Universität Berlin (Wirtschaftswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Der Abbau von Bodenschätzen und die Erzeugung von Strom haben in unserer Industriegesellschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Überall auf der Welt entstehen neue Kernkraftwerke und Tagebauten zur Rohstoffgewinnung. Mit der Errichtung und Inbetriebnahme von solchen Werken entsteht jedoch in den meisten Ländern eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle und zur Rekultivierung der Werke nach Ablauf der Nutzungsdauer. Dabei stellt sich die Frage, wie die immensen zukünftigen Entsorgungskosten finanziert werden. Eine quantitative Abschätzung der Entsorgungskosten ist mit großen Unsicherheiten behaftet, da z.B. im kerntechnischen Bereich noch keine Erfahrungswerte vorhanden sind.Um zukünftige Entsorgungskosten finanzieren zu können, sieht der Gesetzgeber eine Bilanzierung von Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen vor. Dieser Bilanzierung kommt die Aufgabe zu, die künftigen Entsorgungskosten, die in der heutigen Nutzung eines solchen Werkes begründet liegen, dem Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung zuzurechnen. Dabei vermindert die Bildung von Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen den zu versteuernden Gewinn und somit die Ertragssteuerbelastung der entsorgungspflichtigen Werksbetreiber. Die durch diese Steuerstundung generierten Gelder stehen dem jeweiligen Unternehmen bis zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit in voller Höhe zur freien Verfügung und können z.B. zur kostengünstigen Innenfinanzierung herangezogen werden.Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit die Bilanzierung von solchen Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen nach den verschieden Rechnungslegungssystemen zweckmäßig ist und wie diese Verpflichtungen behandelt werden, wenn sich die Gesetzeslage nach einigen Jahren verschärfen sollte.Zwischen den verschiedenen Rechnungslegungssystemen nach dt. Recht, US-GAAP und IFRS gibt es bezüglich der Behandlung von Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen zum Teil gravierende Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Anfang September 2003 wurde der Interpretationsentwurf IFRIC D2 veröffentlicht, welcher Richtlinien zur Bilanzierung solcher Verpflichtungen nach IFRS beinhaltet. Ob dieser Entwurf zukunftsweisend ist und welches Rechnungslegungssystem die Bilanzierung von Entsorgungs- und Rekultivierungsrückstellungen am besten erfasst, wird in dieser Arbeit analysiert.Gang der Untersuchung:Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Bilanzierung von Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen miteinander zu vergleichen und zu bewerten. Dabei werden Konkretisierungsansätze wie z.B. der IFRIC D2 vorgestellt und analysiert. Um das Ziel zu erreichen, wird folgende Vorgehensweise gewählt:In Teil 2 werden die bestehenden Regelungen zur Bilanzierung von Entsorgungs- und Rekultivierungsrückstellungen nach den verschiedenen Rechnungslegungssystemen dargestellt. Dabei wird zum einen der grundsätzliche Ansatz erörtert, des Weiteren erfolgt eine Betrachtung der Zugangs- und Folgebewertung. Letztendlich wird auf die Problembereiche eingegangen.In Teil 3 der Arbeit wird der Interpretationsentwurf IFRIC D2 vorgestellt. Dieser soll Richtlinien für die Behandlung von späteren Änderungen der Höhe der angesetzten Verbindlichkeit beinhalten. Der IFRIC D2 wird in diesem Teil hinsichtlich der Konsistenz mit anderen Normen analysiert. Folgend wird er mit anderen Vorschlägen verglichen und es werden Divergenzen herausgearbeitet.Im abschließenden Teil 4 werden die erarbeiteten Zwischenergebnisse zusammengefasst und in Bezug zur weiteren Entwicklung sowie zum gegenwärtigen Stand der verschiedenen Rechnungslegungssysteme gese. 76 pp. Deutsch.
-
Theoretische Konzeption und praktische Implementierung von Lernsoftware für ausgewählte Bereiche des Operations Research: Transportalgorithmen
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683226ISBN 13: 9783838683225
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Informatik - Software, Note: 1,7, Universität Leipzig (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, empirische Wirtschaftsforschung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Der Transport von Waren, vom Ort der Produktion zu den Märkten, war schon immer ein bedeutender Bestandteil in der Wirtschaft. Für den Standort eines Unternehmens ist auch heute noch die Anbindung an die Verkehrswege von entscheidender Bedeutung, da der Transport von Waren einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor darstellt.Im Zeitalter der Globalisierung und des Internets rücken die Entfernungen zwischen dem Ort der Produktion und dem Ort des Konsums immer weiter auseinander. Große internationale Konzerne produzieren in Ländern mit niedrigen Arbeitslöhnen und können trotz riesiger Transportstrecken bessere Preise als lokale Produzenten, anbieten. Der Vorteil der billigeren Produktion gegenüber möglichen Konkurrenten kann nur solang ein Vorteil sein, bis die Kosten für den Transport der Waren zum Markt den Produktionskostenvorteil aufheben. Aus diesem Grund sollten die Transportkosten so niedrig wie möglich gehalten werden, denn mit der Einsparung von Transportkosten steigt der Gewinn des Unternehmens. Die Kostensenkung durch eine Reduzierung der Transportkosten wird mit der Planung und Auswahl von optimalen Transportwegen erreicht. Durch ein Unternehmen sind häufig folgende Entscheidungen zu treffen: Was wird von welchen Produktionsstandort, zu welchem Markt, zu welcher Zeit und zu welchen Kosten transportiert. Diese Entscheidungen sind so komplex und wichtig für das Unternehmen, dass fundierte Methoden angewendet werden müssen, die den Entscheidungsträgern eines Unternehmens die Entscheidungsfindung erleichtern.Die Notwendigkeit logistischer und anderer kriegsstrategischer Entscheidungen während des zweiten Weltkrieges erforderten die Entwicklung mathematischer Methoden für eine optimale Lösung der Entscheidungsprobleme. Aus diesem kriegsstrategischen Zusammenhang entstand in England und den USA ab dem Jahr 1940 das Operations Research (OR), dass sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzte.Eine Definition, was Operations Research besonders charakterisiert, wurde durch die OR-Gesellschaft Operational Research Society beschrieben: Unter Operations Research versteht man die Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf das Problem der Entscheidungsfindung in der Unsicherheits- oder Risikosituation, mit dem Ziel, den Entscheidungsträgern bei der Suche nach optimalen Lösungen eine quantitative Basis zu liefern. Dabei können grundsätzlich Erkenntnisse aus allen wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen werden .Die Erkenntnisse und Methoden des Operations Research hielten nach Beendigung des zweiten Weltkrieges Einzug in mathematische Planungsmethoden der Privatwirtschaft und sind durch den großen Konkurrenzdruck zwischen den Unternehmen unabdingbar geworden. Das Optimalitätsstreben, die modellanalytische Vorgehensweise, die genaue Problemquantifizierung der Entscheidungsprobleme und die Möglichkeiten der Entscheidungsvorbereitung, welche sich in den OR-Methoden wiederspiegeln, machen das Operations Research sehr attraktiv für Privatunternehmen. Vor allem das Optimalitätsstreben deckt sich mit der unternehmerischen Zielsetzung der Gewinnmaximierung. Dies führte dazu, dass die OR-Methoden nicht nur an Universitäten, sondern auch in der Wirtschaft weiterentwickelt wurden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich das Operations Research bis 1975 vorwiegend mit betriebswirtschaftlichen Problemstellungen auseinandersetzte. Anwendungsgebiete im privatwirtschaftlichen Bereich umfassen:- Telekommunikation.- Logistik (z.B. Transport- und Tourenplanung).- Produktionsplanung und steuerung.- Projektmanagement und steuerung.- Investitions- und Finanzplanung.Durch die Entwi. 88 pp. Deutsch.
-
QM-Systeme im Krankenhaus
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 383868334XISBN 13: 9783838683348
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 2,3, Fachhochschule Flensburg (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem praxisorientierten Vergleich dreier Qualitätsmanagementsysteme (QM-Systeme) im Krankenhaus. Die Auswahl betrifft die in Deutschland gängigsten QM-Systeme EFQM, KTQ und DIN EN ISO 9001:2000.In den Kapiteln 5.1 und 5.2 werden die QM-Systeme anhand des Aufwands und des Nutzens dargestellt.Unterstützt durch einen Vergleich bezüglich:- Kosten-Effektivitäts-Analyse.- Kosten-Nutzwert-Analyse.- Kosten-Nutzen-Analyse.wird ein Aufschluss über die Einsetzbarkeit des QM-Systems im Krankenhaus gegeben.Der praxisorientierte Vergleich der drei QM-Systeme soll verdeutlichen, welches das beste Verhältnis bezüglich Aufwand und Nutzen für das Krankenhaus darstellt. Welches ist das beste QM-System Ein theoretisches Modell zur Bewertung von QM-Systemen:Im folgenden Abschnitt werden drei Verfahren beschrieben, die ein theoretisches Modell zur Bewertung von QM-Systemen darstellen sollen.Dabei wird der Frage nach Höhe der Investition (Aufwand) und des Ertrages nachgegangen.Input-Output-Relation:Um die Eignung eines Qualitätsmanagementsystems für ein Krankenhaus zu beurteilen, bieten sich drei verschiedene grundlegende ökonomische Konzepte an:- Kosten-Effektivitäts-Analyse.- Kosten-Nutzwert-Analyse.- Kosten-Nutzen-Analyse.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABKÜRZUNGSVERZEICHNISVIIABBILDUNG SVERZEICHNISIXTABELLENVERZEICHNISX1.EINLEITUNG11.1Ein theoretisches Modell zur Bewertung von QM-Systemen11.1.1Kosten-Effektivitäts-Analyse21.1.2Kosten-Nutzwert-Analyse31.1.3Kosten- Nutzen-Analyse42.QUALITÄTSMANAGEMENT IM KRANKENHAUS82.1Frühformen des Qualitätsmanagements im Krankenhaus82.2Außerdeutsche Entwicklungslinien und Einflüsse92.2.1Wurzeln der DIN EN ISO 9001:200092.2.2Wurzeln der EFQM102.2.3Wurzeln der KTQ112.3Entwicklung der gesetzlichen Anforderungen122.4Entwicklung der QM-Bewegung im Krankenhaus seit der Einführung der Verpflichtung zur Einführung von QM im SGB V 1999153.GRUNDLAGEN QUALITÄTSMANAGEMENT183.1Definition Qualität183.2Management203.3Qualitätsmanagement213.4Qualitätsmanagementsystem234.QUAL ITÄTSMANAGEMENTSYSTEME254.1KTQ254.1.1Entwicklung254.1.2Aufba u des Modells264.1.3Bewertung der Erfüllung der Anforderungen (PDCA-Zyklus)284.1.4Bewertungsverfahren (Visitation)324.2EFQM354.2.1Herkunft354.2.2Aufbau des Modells (Excellence Modell)364.2.3Bewertungslogik (RADAR-Matrix)374.2.4Bewertungsverfahren (Assessment)394.3DIN EN ISO 9001444.3.1Herkunft444.3.2Aufbau des Modells444.3.3Bewertung der Erfüllung der Anforderungen (Abweichungen)474.3.4Bewertungsverfahren (Audit)504.4Qualitätsmanagementsysteme - Allgemeiner Vergleich535.VERGLEICHSPARAMETER DER PRAKTISCHEN NUTZUNG DER QM-SYSTEME545.1Aufwand545.1.1Aufwand beim Aufbau des QM-Systems545.1.2Aufwand der Zertifizierung/Auszeichnung585.1.2.1KTQ Zertifizierung585.1.2.2EFQM635.1.2.3DIN EN ISO 9001:2000675.1.3Aufwand der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des QM-Systems bezüglich der erneuten Zertifizierung bzw. Auszeichnung705.1.4Anforderungen, Inhalte und Kosten der Qualifizierung735.1.4.1KTQ735.1.4.2EFQM765.1.4.3DIN EN ISO 9001:2000815.1.5Kosten der Zertifizierung/Auszeichnung855.1.5.1KTQ855.1.5.2EFQM895.1.5.3DIN EN ISO 9001:2000945.2Nutzen985.2.1Wahrscheinlichkeit des Scheiterns9. 176 pp. Deutsch.
-
Motivation durch Führung
Editore: Diplom.De Okt 2004, 2004
ISBN 10: 3838683137ISBN 13: 9783838683133
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Libro Print on Demand
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Magisterarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 2,0, Katholische Hochschule NRW; ehem. Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Aachen (Sozialwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Motivation durch Führung, welch ein vielfältig publiziertes Thema. Regina von Diemer (2001) hat einen Artikel mit dem Thema Mitarbeitermotivation durch richtige Führung. in dem Buch Qualitätsmanagement geschrieben. Dieser Titel präzisiert treffend den oberen Titel dieser Masterarbeit. Der Autor bemühte bei der Literaturrecherche zu dieser Arbeit das Internet und fand zu diesem Themenkomplex 71.728 Einträge. Die hohe Zahl der Beiträge dokumentiert ein breites Interesse vieler Personen an diesem Themenkomplex, da das Mitarbeiterengagement sowie die daraus resultierende höhere Arbeitsleistung, nicht unwesentlich von der Motivationsfähigkeit des Vorgesetzten beeinflusst wird und somit eine zentrale Führungsaufgabe darstellt.Im zweiten Kapitel werden neben grundlegenden begrifflichen Definitionen, inhalts- und prozesstheoretische Ansätze zur Motivationsforschung dargestellt.Im dritten Kapitel richtet der Autor den Focus eingehender auf den Bereich der Führung und Führungspraxis, wobei die Auswirkungen einer unangemessenen Mitarbeiterführung genauso diskursiv behandelt werden, wie die Darstellung verschiedener Führungsstile.Im vierten Kapitel werden verschiedene immateriellen und materiellen Motivations-instrumente dargestellt, insbesondere mit einem stärkeren Bezug auf den Themenbereich Personal.Das fünfte und letzte Kapitel diskutiert die dargestellten Ansätze bezüglich der Umsetzung angesichts der gesamtgesellschaftlichen Situation. Dabei wird der Blick auf die Situation sozialökonomischer Betriebe gerichtet und mögliche Zukunftsentwicklungen skizziert.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIIAbbildungsverzeichnisIV1.Einleitung12.Begriffli che Klärung verschiedener Begriffe22.1Ohne Identifikation keine Motivation 52.2Inhaltstheoretische Ansätze zur Motivation52.3Prozesstheoretische Ansätze zur Motivation112.4Was leisten beide Ansätze bezüglich bestehender Grenzen der Motivierbarkeit von Mitarbeitern 153.Führung und Führungspraxis173.1Die Auswirkung einer unangemessenen Mitarbeiterführung173.2Was macht Führung aus 253.3Führungsstile303.4Sprengers Führungsansatz343.5Vergleich der dargestellten Praxisansätze383.6Führungspraxis404Ausgewählte Motivationsinstrumente424.1Immaterielle Motivationsinstrumente434.1.1Personalmanagement als wichtiger Faktor motivationsoptimierender Führungskultur434.1.2Motivationssteigerung durch Vertrauen444.1.3Führung durch Vorbildfunktion464.1.4Führung durch Coaching (Personalbetreuung)474.1.5Information und Kommunikation484.1.6Motivation durch Zielvereinbarungen (MbO)494.1.7Motivation durch Delegation514.1.8Anerkennung und Kritik544.1.9Partizipation der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen554.1.10Mitwirkung der Mitarbeiter an der Gestaltung und den Inhalt ihrer Tätigkeit564.1.11Flexible Arbeitszeitgestaltung584.1.12Arbeitsplatzsicherheit614.1.13Motivation durch Weiterbildung- und Entwicklungsmöglichkeiten614.1.14Kritische Analyse der aufgezeigten Instrumente zur Motivationssteigerung624.2Auswirkungen der Kultur und der Organisation des Unternehmens auf die Motivation644.3Materielle Motivationsinstrumente684.3.1Wirkt Geld motivationsfördernd 694.3.2Leistungsabhängige Vergütung714.3.3Ertragsorientierte Bezahlung734.3.4Team- und Gruppenorientierte Vergütung744.3.5Freiwillige Sozialleistungen zur verbesserten Mitarbeiterbindung754. 112 pp. Deutsch.